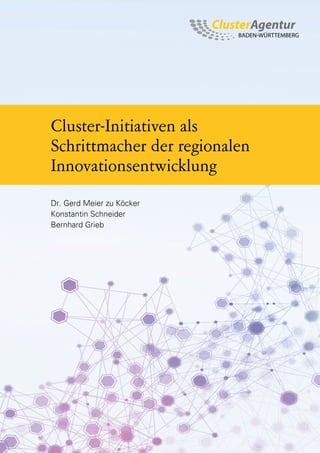
Cluster Initiativen als Schrittmacher regionaler Innovationsentwicklungen
- 1. Cluster-Initiativen als Schrittmacher der regionalen Innovationsentwicklung Dr. Gerd Meier zu Köcker Konstantin Schneider Bernhard Grieb
- 2. 2 Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Impressum: Herausgeber ClusterAgentur Baden-Württemberg im Auftrag vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg Haus der Wirtschaft Willi-Bleicher-Straße 19 70174 Stuttgart Telefon: +49 711 123-3033 www.clusteragentur-bw.de Autoren Dr. Gerd Meier zu Köcker Konstantin Schneider Bernhard Grieb Gestaltung VDI/VDE-IT Berlin Bildnachweise Titel: © alexaldo/Thinkstock; Seite 14: © Andy Grimm/Fo- tolia; Seite 22: © Cluster Medizintechnologie,Seite 23: © Thomas Hecker/Fotolia, Seite 25: © thyssenkrupp AG, Seite 27: © Carol_Anne/Thinkstock, Seite 28: © Hein Nouwens/ Fotolia, © goodzone95/Fotolia, © Evgeniya M/Fotolia, © Fla- vijus Piliponis/Fotolia, © ylivdesign/Fotolia, © Erhan Ergin/ Fotolia Stand Dezember 2017
- 3. 1Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Inhalt 1 Einleitung.......................................................................................................................................................3 2 Der Innovationswettbewerb RegioWIN ......................................................................................................5 2.1 Wesentliche Erkenntnisse des Wettbewerbes.......................................................................................6 2.2 Weiterführung der regionalen Innovationsstrategien..............................................................................7 3 Wesentliche Akteure eines regionalen Innovationsstrategie-Prozesses....................................................................................................................8 3.1 Cluster-Initiativen im Kontext regionaler Wirtschaftsstrukturen..............................................................9 4 Neue Instrumente für die Entwicklung regionaler Innovationsstrategien unter Einbindung von Cluster-Initiativen .............................................................................................................12 4.1 Regionales Cluster-Portfolio....................................................................................................................12 4.2 Dashboard Cluster-Services ...................................................................................................................15 4.3 Innovationsausblick.................................................................................................................................16 4.4 Entrepreneurial Discovery Workshop......................................................................................................18 5 Erfolgversprechende Ansätze zur Nutzung von Cluster-Initiativen im Kontext regionaler Innovationsstrategien ................................................................................................................20 5.1 Baden-Württemberg ...............................................................................................................................20 5.1.1 Smarte Clusterentwicklung in Mannheim – Integrierter Ansatz der kommunalen Wirtschaftsförderung.............................................................................................22 5.1.2 Technologieverbund als „Cross-Sektorales-Dach“ in der ländlich geprägten Industrieregion Schwarzwald-Baar-Heuberg................................................................................24 5.2 Freie und Hansestadt Hamburg...............................................................................................................26 5.2.1 Hamburg – Cluster-Brücken mit System......................................................................................26 5.3 Europäische Regionen ............................................................................................................................28 5.3.1 IDM Südtirol – vom Cluster zum regionalen Ecosystem-Ansatz...................................................28 5.3.2 Süddänemark – Cluster-Initiativen als Koordinator regionaler Kooperationsmodelle....................29 6 Implikationen für Baden-Württemberg........................................................................................................31 7 Literaturverzeichnis.......................................................................................................................................33 8 Abkürzungsverzeichnis.................................................................................................................................34
- 4. 2 Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber
- 5. 3Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Einleitung 1 Innovationsstrategie Baden-Württemberg (2013), https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-wm/intern/Publikationen/Innovation/InnovationsstrategieBW.pdf. 2 Vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (Hrsg.): Forschungs- und Entwicklungsmonitor Baden-Württemberg, in: Statistische Analysen 2/2016, S. 7. 1 Einleitung Baden-Württemberg hat sich erfolgreich den Herausfor- derungen der Globalisierung in den vergangenen Jahr- zehnten gestellt. Es ist ein industrie- und exportinten- sives Bundesland, das einerseits Industriegiganten von Weltruf beherbergt, andererseits aber nach wie vor durch eine mittelständische Wirtschaftsstruktur geprägt ist. Zu- dem verfügt Baden-Württembergs Wirtschaft über eine Reihe von sehr starken Clustern, eine hohe Forschungs- und Technologiekompetenz, eine ausgeprägte Internati- onalität und das Zusammenspiel von Großunternehmen und Mittelstand. Gleichzeitig besteht kein Zweifel, dass den Regionen in Baden-Württemberg signifikante strukturelle Herausfor- derungen bevorstehen. Die Veränderung traditioneller, lange bewährter Strukturen stellt für Regionen, Landkrei- se, Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg eine entsprechende Herausforderung dar. Die Digitalisierung, der Trend zur Elektromobilität und die zunehmende Kon- vergenz von Technologien verändern traditionelle Sek- toren und Industrien in ihrem Kern oder transformieren diese signifikant. Die Notwendigkeit, Dinge zu verändern und sich dabei auf eigene Stärken und Ideen zu besinnen, eröffnet den Regionen und ihren Akteuren aber auch ganz neue Perspektiven und Chancen. Dabei ist es das Ziel der Wirtschaftspolitik des Landes, durch die Schaffung ef- fektiver wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen das überdurchschnittliche Beschäftigungs- und Wohlstands- niveau Baden-Württembergs zu erhalten und dabei mit- zuwirken, dass sich die Unternehmen des Landes den veränderten nationalen und internationalen Herausforde- rungen erfolgreich stellen können und die Wettbewerbs- fähigkeit des Landes weiter ausgebaut wird. In Baden-Württemberg wurde die Wichtigkeit der regi- onalen Innovationsakteure und Unterstützungsinstituti- onen (Intermediäre) schon frühzeitig erkannt. Folgerich- tig wurde der strategische Ansatz der Innovationspolitik seit langem dynamisch und iterativ weiterentwickelt. So wurden im Laufe der Jahre Plattformen und Gremien geschaffen, um den Dialog zwischen den Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zu initiieren. In die- sem Kontext wurden gemeinsam konkrete wirtschafts- politische Ziele formuliert und Maßnahmen durchgeführt. Es wurde z. B. schon in den 1990er Jahren mit dem Inno- vationsrat ein Instrument geschaffen, das den Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren ermöglicht hat. Aus diesen ersten Erfahrungen sind im Laufe der Zeit verschiedenste Dialogformate entstanden (Abbildung 1). Hierbei ist vor allem der Regional-Dialog als wichtiges Instrument zu nennen. Im Rahmen der Regional-Dialoge begleitete bzw. begleitet das Land die regionalen Akteure bei der Implementierung eines kontinuierlichen Verbes- serungsprozesses zur Mobilisierung der in den Regionen vorhandenen Potenziale und zur Verbesserung regionaler Standortfaktoren. Es ist nicht verwunderlich, dass Baden-Württemberg seit Jahren einen Spitzenplatz unter den innovativsten Regi- onen in Europa einnimmt2 . Dieses gute Innovationsran- king ist u. a. auf die hohen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung und die Innovationskraft der Unterneh- Abbildung 1: Formate der dialogorientierten Innovations- und Wirtschaftspoli- tik in Baden-Württemberg1 Themen dialoge u. a.: • Fachkräfte allianz • Ausbil- dungs- bündnis • Cluster dialog • Rohstoff dialog Implementierung / Umsetzung • Wirtschaftsgespräche mit Kammern, Verbänden, Gewerk- schaften Branchen-/ Sektordialoge u. a.: • Automobil • Gesund- heitsindus- trien • IKT • Kreativ wirtschaft • Logistik • Luft- und Raumfahrt • Maschinen- bau Regional dialoge u. a.: • Pro-aktive Regional- Dialoge • Situations- bezogene Regional- Dialoge
- 6. 4 Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Einleitung men zurückzuführen. Die gute FuE-Infrastruktur und die Existenz bzw. das Zusammenwirken der Innovations-In- termediäre fördern außerdem diese Innovationskraft der Unternehmen. Die über Jahre hinweg etablierte Cluster- und Netzwerklandschaft hilft Unternehmen, die richtigen Partner zu finden und in „geschützten“ Räumen mitei- nander zu kooperieren. Bei genauerer Betrachtung wird aber auch deutlich, dass die Innovationsfähigkeit der Sub-Regionen innerhalb Baden-Württembergs teilweise sehr unterschiedlich verteilt ist, wie Abbildung 2 zeigt. Weiterhin wird deutlich, dass die Beteiligung von kleinen und mittleren Unternehmen am Innovationsgeschehen über Jahre hinweg kontinuierlich zurückgegangen ist4 . Diese Tatsache zeigt kontinuierliche und perspektivisch auch strukturelle Risiken für den Wirtschafts- und Innova- tionsstandort Baden-Württemberg. Weitere Risiken sind auch darin zu erkennen, dass die guten Innovationswerte bei den FuE-Aufwendungen durch wenige Branchen und in diesen durch wenige Global Player gestellt werden. Es ist daher davon auszugehen, dass die Ursachen für die unterschiedliche Innovationskraft auf der subregionalen Ebene in den regional sehr unterschiedlichen Herausfor- derungen in Bezug auf Wirtschaftsstruktur, Topografie, Demografie und Vernetzung zwischen den Innovations- akteuren zu finden sind5 . Hierbei ist darauf zu achten, dass mögliche Konzepte für die Weiterentwicklung bzw. Anpassung der Regionen an die zukünftigen Herausfor- derungen aufgrund der subsidiären Aufgabenverteilung in Baden-Württemberg nur von den Akteuren auf der subregionalen Ebene entwickelt und umgesetzt werden können. Abbildung 2: Innovationsfähigkeit der Regionen Baden-Württembergs3 3 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. 4 Baden-Württembergischer Handelskammertag (Hrsg.): Technologiepolitik in Baden-Württemberg 2015, S. 2. 5 Magdalena Häberle, RegioWIN – Interregional Competition as a means of successfully involving regional stakeholders in Smart Specialisation and bottom-up approach für ITI, Ministry of Economic Affairs, Labour and Housing Baden Württemberg, 2016.
- 7. 5Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Der Innovationswettbewerb RegioWIN 2 Der Innovationswettbewerb RegioWIN Um für die Regionen in Baden-Württemberg bei der Ver- besserung der Standortfaktoren in den funktionellen Räu- men des Landes (d. h. unterhalb von NUTS I) Unterstüt- zung zu leisten, initiierte das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau (WM) im Zusammenwirken mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst sowie dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz den zweistufigen, sog. Innovations- wettbewerb RegioWIN (Regionale Wettbewerbsfähig- keit durch Innovation und Nachhaltigkeit). Gleichzeitig transformierte dieser erstmals auch die Fortführung des Ansatzes der intelligenten Spezialisierung (S3) auf regi- onaler Ebene. Aus Sicht Baden-Württembergs stellt der Ansatz der intelligenten Spezialisierung ein für die regi- onale Entwicklung hilfreiches Konzept dar. Im Idealfall geht es darum, auf der Ebene des entsprechenden funk- tionalen Raums das regionale Stärkespektrum (Stärkefel- der) zu ermitteln und dieses durch eine Orientierung der öffentlichen Investitionen möglichst gut zu stabilisieren bzw. auszubauen, um damit einen Beitrag zur Stärkung des Wirtschafts- und Beschäftigungswachstums zu leis- ten. Wichtig ist hierbei, dass sich die regionalen Strategi- en auf die Schwerpunktfelder von Baden-Württemberg beziehen, gleichzeitig aber auch die existierenden Stärke- felder in den entsprechenden Regionen berücksichtigen. Durch RegioWIN wurden Regionen, Landkreise, Städte und Gemeinden motiviert, sich mit den relevanten Ak- teuren aus Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung eine gemeinsame Zukunftsstrategie im Sinne der intelligenten Spezialisierung für einen funktionalen Raum zu erarbeiten (regionale Entwicklungskonzepte). Auf eine Definition der Region wurde bewusst verzichtet, damit sich die Akteure frei zusammensetzen konnten. Allerdings musste dabei das Prinzip der Einräumigkeit bewahrt werden. Das be- deutet, eine Stadt oder ein Landkreis durfte nur an einem Strategiekonzept mitarbeiten, aber nicht an unterschied- lichen. Zielgruppe des Wettbewerbs waren vor allem regiona- le Akteure, die die konzeptionelle und strategische Ent- wicklung des funktionalen Raumes und deren spätere Umsetzung mitgestalten. Dazu gehören u. a. relevante Akteure aus den Kommunen, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Verwaltung in den Regionen. Dies konn- ten beispielsweise Städte, Gemeinden, Kreise, Verbän- de, Kammern, Wirtschaftsförderungsgesellschaften etc. sein. Wettbewerbsteilnehmer/-innen waren regionale Partner und Multiplikatoren, die für den Wettbewerbsbeitrag ver- antwortlich waren und eine wesentliche koordinierende Rolle im regionalen Entwicklungsprozess übernahmen. Sie kamen in der Regel aus den Reihen der regionalen Akteure, die für die Entwicklung des funktionalen Rau- mes eine umfassende Verantwortung und Zuständigkeit haben, z. B. Gebietskörperschaften, Kammern, Verbände, Gewerkschaften. Eine wichtige Rolle im Kontext der v. g. regionalen Part- ner kommt den Cluster-Initiativen zu. Durch Nähe zu den Zielgruppen der KMU, Innovationsakteure einerseits aber auch Wettbewerbsteilnehmer/-innen andererseits, konn- ten sie sowohl einen koordinierenden als auch einen fachlichen Input leisten. Die Intensität der Einbindung der Cluster-Initiativen variierte bei RegioWIN jedoch stark zwischen den Regionen bzw. den Wettbewerbsteilneh- mer/-innen. Der Wettbewerb untergliederte sich in zwei Phasen. • In der ersten Phase waren regionale Vertreter dazu aufgerufen, für selbst definierte regionale Räume eine Strategie zu entwickeln, die eine gemeinsa- me Zielsetzung für ein regionales Innovations- und Wachstumsprofil beinhalten. Basieren sollte diese Zielsetzung auf einer sozioökonomischen Analyse und gemeinsamen Verständigung der regionalen Akteure über Stärken / Schwächen sowie Chancen / Risiken in der Region. In diesen Konzepten sollten außerdem schon erste Leuchtturmprojekte zur Erreichung der gesetzten Ziele erarbeitet werden. Eine unabhängige und interdisziplinäre Jury bewertete die eingereichten Wettbewerbsbeiträge und wählte die besten Beiträge für die zweite Wettbewerbsphase aus. Insgesamt wurden 14 Konzepte eingereicht, elf Regionen wurden aufgefordert, sich an der zweiten Wettbewerbsphase zu beteiligen. Sie erhielten für die Weiterentwicklung ihrer Konzepte ein Budget jeweils von ca. 50.000 Euro. • Die Strategiekonzepte aus der ersten Phase des Wett- bewerbs galt es in der zweiten Phase zu regionalen Entwicklungskonzepten weiterzuentwickeln. Vor allem die Leuchtturmprojekte mussten weiter konkretisiert werden. So musste ein detaillierter Kosten-, Finanzie- rungs- und Zeitplan für die Projekte erstellt werden. Letztlich mussten diese bei der Antragstellung umset-
- 8. 6 Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Der Innovationswettbewerb RegioWIN zungsreif sein. Die Qualität der eingereichten regio- nalen Entwicklungskonzepte war so hoch, dass die Jury an alle elf teilnehmenden Wettbewerbsregionen der zweiten Phase das Label „WIN-Region“ vergab. Zugleich konnten 21 der 61 eingereichten Leucht- turmprojekte prämiert werden und damit grünes Licht für die Beantragung einer Förderung aus EFRE-Mittel erteilt werden. Insgesamt wurden für die Bewilligungen dieser Leucht- turmprojekte fast 107 Mio. Euro an EU- und Landesmit- teln eingesetzt, von denen rund 76 Mio. Euro aus dem EFRE-Budget stammten und rund 30 Mio. Euro aus Lan- desmitteln. Jedes Leuchtturmprojekt konnte für seine Projektkosten von maximal 10 Mio. Euro pro Projekt eine 70-prozentige Förderung erhalten. Abbildung 3 zeigt die prämierten Wettbewerbsregionen Phase 1 und 2. RegioWIN war und ist ein wichtiger Impuls, um in allen Regionen des Landes einen regionalpolitischen Strate- gieprozess im Sinne einer intelligenten Spezialisierung in Gang zu setzen. Selbst Regionen, die nicht als WIN-Re- gionen prämiert wurden, fanden die Impulse des Wett- bewerbes sinnvoll und wollen den begonnenen Prozess fortführen. 2.1 Wesentliche Erkenntnisse des Wettbewerbes RegioWIN kann bereits heute als Erfolg angesehen werden. Das Prinzip der Einräumigkeit zwang die Wett- bewerbsteilnehmer/-innen, über historisch gewachse- ne Grenzen hinweg einen Konsens über den Zuschnitt ihrer Wettbewerbsregionen zu finden. Auf diese Weise wurden die Verflechtungen innerhalb dieser Räume auf vielen Ebenen bewusst gemacht sowie ein Anlass da- für geschaffen, sich mit unterschiedlichen, auch neuen Stakeholdern zu arrangieren. Somit bewirkte der Wett- bewerb eine kritische Reflektion der traditionellen und historisch gewachsenen Verwaltungsgrenzen. RegioWIN bot die Chance, abweichend von den gewachsenen Ver- waltungsgliederungen funktionale Räume zu definieren, die real existierende regionale Verflechtungen abbilden und sie zu einer strategischen Gemeinschaft formieren7 . Bereits die erste Phase führte dazu, dass eine große An- zahl von Akteuren flächendeckend involviert war. Durch die 14 Wettbewerbsregionen, die sich in der ersten Pha- se beteiligten, war das gesamte Territorium abgedeckt. Hinzu kam ein sehr hoher Mobilisierungsgrad von über 1.500 Akteuren. Nunmehr läuft die Implementierungsphase in den prä- mierten Regionen, in die die Akteure aktiv involviert sind, die Konzepte umzusetzen. Abschließend kann festge- stellt werden, dass es mit RegioWIN gelungen ist, in allen Regionen einen regionalen, strategischen Entwick- lungsprozess in Gang zu setzen. Allerdings müssen die regionalen Konzepte, sowohl die geförderten als auch die bisher nicht geförderten, kontinu- ierlich weiterentwickelt und an neue Herausforderungen angepasst werden. Mit Hilfe des Projektes RegioINNO wurde in konsequenter Fortsetzung in allen Regionen das Thema „Regionale Innovationssysteme“ (als Teilmenge Abbildung 3: Übersicht über prämierte Leuchtturmprojekte im Rahmen von RegioWIN6 (Quelle: © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2018; Kartengrundlage GfK GeoMarketing GmbH, Karte erstellt mit RegioGraph, 2018) 6 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, Der RegioWIN Prozess, 2016. 7 Magdalena Häberle, RegioWIN – Interregional Competition as a means of successfully involving regional stakeholders in Smart Specialisation and bottom-up approach für ITI, Ministry of Economic Affairs, Labour and Housing Baden Württemberg, 2016.
- 9. 7Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Der Innovationswettbewerb RegioWIN einer gesamten regionalen Entwicklungsstrategie) erfolg- reich platziert. 2.2 Weiterführung der regionalen Innovations- strategien RegioWIN war ein wichtiger erster Schritt, um die regi- onalen Akteure besser miteinander zu vernetzen und zu einem gemeinsamen regionalen Handeln zur Stärkung des regionalen Wirtschaftsstandorts zu bewegen. Damit wurde in den Regionen eine gute Grundlage geschaf- fen, um eine weitere Konkretisierung des innovativen Leistungsprofils, beispielsweise in Bezug auf regionale Alleinstellungsmerkmale in der Innovationskraft oder in den industriellen Stärken oder in einer Verschränkung der einzelnen Kompetenz- und Technologieprofile, in de- nen primär die künftigen innovationspotenziale liegen, anzugehen, die über eine allgemeine Beschreibung (wie z. B. Automotive, Maschinenbau, IKT etc.) hinausgehen. Wichtige Aspekte einer regionalen Innovationsstrategie lassen sich auf diese Weise finden. Einzelne Räume, wie z. B. die Stadt Mannheim, die Metropolregion Rhein- Neckar oder die TechnologieRegion Karlsruhe oder auch der Ostalbkreis haben über Jahre hinweg solch regionale Innovationskonzepte rudimentär entwickelt oder bereits implementiert. Aus Sicht der Akteure, die regionale Innovationsstrategi- en vorantreiben wollen, existieren drei wesentliche Bar- rieren: • Mangelndes Bewusstsein für die Notwendigkeit re- gionaler Innovationsstrategien. Die Wirtschaft in Ba- den-Württemberg entwickelt sich seit Jahren überaus erfreulich; die Unternehmen können den nationalen und internationalen Bedarf kaum decken. In solchen Boom-Zeiten ist es schwierig, den regionalen Akteu- ren zu vermitteln, warum regionale Entwicklungskon- zepte für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung notwendig sind. Außerdem ist die Thematik für man- che Akteure noch vergleichsweise neu oder lässt sich zum Tagesgeschäft dazu nicht verfolgen. • Das fehlende Wissen, wie regionale Innovationskon- zepte entwickelt werden sollen. Da die Entwicklung von regionalen Innovationsstrategien zur Steigerung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit bisher in der Regel nicht im Verantwortungsbereich der regiona- len Akteure lag, existiert ein vergleichsweise geringes Wissen, wie dieser Prozess zu gestalten ist und wie die Ergebnisse in der Region zu kommunizieren sind. • Fehlende Instrumente für die Konzeption und Imple- mentierung regionaler Innovationsstrategien. Die zukünftige Herausforderung besteht also darin, diese Barrieren und Unsicherheiten der potenziellen Akteure, die für die Entwicklung und Umsetzung von derartigen regionalen Entwicklungskonzepten im Sinne eines kon- tinuierlichen regionalen Verbesserungsprozesses zustän- dig sind, zu beseitigen. Zudem muss es darum gehen, sie dabei aktiv zu unterstützen und einen Grundstein dafür zu schaffen, dass möglichst alle Regionen in Baden-Würt- temberg auf den bevorstehenden strukturellen und tech- nologischen Wandel vorbereitet sind.
- 10. 8 Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Wesentliche Akteure eines regionalen Innovationsstrategie-Prozesses 3 Wesentliche Akteure eines regionalen Innovationsstrategie-Prozesses Unter anderem hat der RegioWIN-Prozess gezeigt, dass neben einem klaren Commitment der Region ein weite- rer wesentlicher Erfolgsfaktor für ein bedarfsgerechtes, zukunftsorientiertes regionales Entwicklungskonzept die aktive Einbindung und Mobilisierung der passenden Akteure einer Region (regionale Akteure) ist. Wichtig ist hierbei auch die richtige „Mischung“ von zu involvieren- den Institutionen und Personen. Folgende Eigenschaften sollten vertreten sein: • Gutes Verständnis für die Stärken und Schwächen in der Region: Für die Identifikation zukünftiger, spe- ziell für die Region relevanter Trends und zu erwarten- der strukturverändernder Prozesse ist es wichtig, dass ein vertiefendes Verständnis über die Stärken und Schwächen einer Region bei den involvierten Akteu- ren vorliegt. Die Ist-Analyse (inkl. einer Bewertung der innovationsorientierten Stärken und Schwächen) steht oftmals am Beginn eines regionalen Entwicklungskon- zeptes. • Kompetenz in den Bereichen Regionalpolitik, Wirt- schaft und Forschung: Regionale Entwicklungs- konzepte zielen auf die nachhaltige Steigerung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit einer Region. Sie adressieren damit in der Regel Aspekte der Wirt- schaft, Wissenschaft und Regionalpolitik bzw. -ent- wicklung. Die entsprechenden Rahmenbedingungen werden in der Regel auf subregionaler und regionaler (und gesamtstaatlicher) Ebene bestimmt. Daher sollten diese Kompetenzen in angemessener Art und Weise vertreten sein. • Erfahrung und Akzeptanz: Wichtig ist, dass die wesentlichen involvierten Akteure sowohl hinsichtlich der Institution als auch der Person als Instanz in der Region respektiert und anerkannt werden. Der Grad der Einbindung der Akteure ist über den Ent- wicklungsprozess hinweg nicht immer gleichbleibend. In der Regel unterteilt sich die Erarbeitung eines regionalen Entwicklungskonzeptes in drei wesentliche Schritte, wie in Abbildung 4 dargestellt. Die Herausforderung besteht darin, die Unterschiedlich- keit der Akteure zu beachten und diese zum richtigen Zeitpunkt in den Entwicklungs- und Umsetzungsprozess einzubeziehen. Abbildung 5 zeigt die wesentlichen Ak- teure eines regionalen Entwicklungsprozesses und ihre Einbindung entsprechend den Phasen der Entwicklung einer regionalen Innovationsstrategie. Eine aktive Einbindung in diesem Zusammenhang be- deutet, dass die jeweilige Akteursgruppe in dieser Phase eine tragende Rolle einnehmen sollte. Das heißt, dass sie den Prozess mitgestalten sowie ihr Wissen und ihre Erfahrung einbringen soll. Hier wird noch unterschieden zwischen einer aktiven Einbindung, die zwingend not- wendig ist, und einer wünschenswerten Einbindung. Eine reaktive (bedarfs- und anlassbezogene) Einbindung bedeutet, dass diese Akteursgruppe bei Bedarf punktuell eingebunden werden sollte. Bei eingehender Betrachtung der Abbildung 5 wird deut- lich, dass Wirtschaftsförderer und Cluster-Initiativen eine besonders aktive Rolle während aller Phasen eines regi- onalen Entwicklungsprozesses einnehmen können. Dies ist nicht verwunderlich, da beide Akteursgruppen in der Region in der Regel das Potenzial und das Aktionsspekt- rum haben, um sehr gut mit Wirtschaft und Wissenschaft vernetzt sein und somit deren Stärken und Schwächen gut kennen zu können. Gerade Cluster-Initiativen reprä- sentieren eine signifikante Gruppe von Akteuren aus Wis- senschaft und Wirtschaft in einem bestimmten Kompe- tenzfeld. Abbildung 4: Wesentliche Phasen eines regionalen Entwicklungsprozesses (Quelle: ClusterAgentur Baden-Württemberg [2017]) Implementierung / Umsetzung Strategische Schwerpunktsetzung Analyse regionaler Stärken und Schwächen
- 11. 9Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Wesentliche Akteure eines regionalen Innovationsstrategie-Prozesses Abbildung 5: Einbindung der verschiedenen Akteure in den verschiedenen Phasen der Entwicklung einer regionalen Innovationsstrategie Akteure eines regionalen Entwicklungsprozesses Analyse Unter- nehmen Wirtschaft Regionalentwicklung Regionale Potenziale Globale Mega Trends Identifizierung struktur veränderter Prozesse Festlegung strategischer Themenschwerpunkte Entwicklung Instrumente / Methoden Durchführung von Aktivitäten und Maßnahmen Umsetzung Evaluation und Performance Measurement Cluster- Initiativen UNI / HS / FI Forschung Regional politik Politik TTZ / IZ Technolo- gietransfer Aktive Einbindung notwendig Aktive Einbindung wünschenswert Reaktive Einbindung Kammern / Verbände WiFö 3.1 Cluster-Initiativen im Kontext regionaler Wirtschaftsstrukturen Cluster-Initiativen sind Netzwerke, in denen in einem konkreten Kompetenzfeld oder einer Technologie die innovationsorientierten Kooperationsbeziehungen zu- nehmend strategisch und systematisch abgestimmt sind, gezielt Kompetenz- und Wertschöpfungslücken ge- schlossen werden und alle Aktivitäten durch eine Cluster- management- oder Trägerorganisation koordiniert bzw. durchgeführt werden. In der Regel sind Cluster-Initiativen als Teil der Wirtschaftsförderung oder des Technologie- transfers in die regionale Struktur- und Innovationspolitik eingebunden8 . Die Clusterpolitik in Baden-Württemberg unterstützt systematisch Entwicklung und Ausbau von solchen Cluster-Initiativen und landesweiten Innovations- netzwerken. Besondere Schwerpunkte liegen dabei auf branchen- oder technologiefeldübergreifenden Koope- rationen sowie Maßnahmen zur Internationalisierung. Erklärtes Ziel der Clusterpolitik des Landes Baden-Würt- temberg ist es, Clustermanagementstrukturen weiter zu professionalisieren und zur Steigerung der Qualität der Clustermanagements beizutragen9 . Die ClusterAgentur Baden-Württemberg ist hierbei ein zentrales Instrument des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungs- bau, den Prozess zur Professionalisierung und Internati- onalisierung der Clustermanagements voranzutreiben10 . Entscheidend für den Erfolg einer Cluster-Initiative ist, dass die Cluster-Akteure aufgrund einer gemeinsamen Zielsetzung und Strategie in der systematischen und or- ganisatorisch verorteten Zusammenarbeit einen höheren 8 Vgl. Analytische und konzeptionelle Grundlagen zur Clusterpolitik in Baden-Württemberg. 2008. 9 Cluster-Atlas Baden-Württemberg 2016, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, https://www.clusterportal-bw.de/fileadmin/media/Download/ Downloads_Publikationen/Regionaler_Cluster-Atlas_Baden-Wuerttemberg_2016.pdf. 10 www.clusteragentur-bw.de.
- 12. 10 Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Wesentliche Akteure eines regionalen Innovationsstrategie-Prozesses Abbildung 6: Schematische Darstellung ausgewählter Charakteristika der Strategieentwicklung von Unternehmen, Cluster-Initiativen und Regionen Charakteristika Unternehmen Cluster-Initiative Region Fokus Einzelnes Unternehmen Viele unterschiedliche Akteure (triple Helix), regionaler Fokus Viele unterschiedliche Akteure (triple Helix), regionaler Fokus Ziel Gewinn, Wettbewerbs- fähigkeit, Wachstum Wettbewerbs- und Inno- vationsfähigkeit Wettbewerbsfähig- keit, Verbesserung der Standortfaktoren Top-down / Bottom-up Top-down Integrativ Bottom-up Integrativ Bottom-up Akteurseinbindung Management, evtl. Berater Kernakteure, Interme- diäre Intermediäre, ausge- wählte Akteure Komplexität der Implementierung Gering - mittel Mittel - hoch hoch Zeithorizont Kurz- bis mittelfristig Mittel- bis langfristig Mittel- bis langfristig Einzel- und Gesamtnutzen erreichen, der ansonsten nicht realisierbar wäre. Konträr zu überregional und landesweit ausgerichteten Netzwerken und losen Kooperationsfor- men zeichnen sich Cluster-Initiativen dadurch aus, dass sie grundsätzlich regional verortet sind und gezielt inno- vative Kooperationspotenziale systematisch aktivieren, um Synergien und Wachstum zu generieren. Durch die intensive und insbesondere frühzeitige Zusam- menarbeit zwischen Unternehmen und Forschungsinsti- tutionen beschleunigt sich der Wissenstransfer. Dadurch profitieren zum einen Unternehmen von den Forschungs- ergebnissen, die somit innovative Produkte und Dienst- leistungen sowohl schneller als auch wettbewerbsfähi- ger in den Markt bringen können, zum anderen finden Forschungseinrichtungen effektiver Wirtschaftspartner für die Umsetzung ihrer Forschungsprodukte. Cluster-Ini- tiativen sind dadurch in der Lage, die Innovationsfähigkeit der Unternehmen bedeutend zu steigern und zur Profil- bildung sowie Positionierung von Regionen im internatio- nalen Wettbewerb beizutragen. Dabei sind Cluster-Initia- tiven, die von der räumlichen Agglomeration der Akteure profitieren, mehr als ein loses Beziehungsgeflecht. Sie agieren zielorientiert, unterstützen die Kompetenzent- wicklung, den Wissensaustausch, die Innovationsgene- rierung und sind an den Erfordernissen einer Wissens- gesellschaft sowie der fortschreitenden Globalisierung ausgerichtet. Hierzu bedarf es einer professionellen Ko- ordination, die in der Regel ein Cluster- bzw. Netzwerk- management übernimmt11 . Durch ihr Wirken im Sinne der Mitglieder aus Wissen- schaft und Wirtschaft leisten Cluster-Initiativen einen wichtigen Beitrag zur Clusterentwicklung. Eine gestei- gerte Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der Mitglie- der einer Cluster-Initiative leistet auch einen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der Region, vor allem dann, wenn die Cluster-Initiative eine kritische Masse an Clusterak- teuren hat. Daher ist es nicht verwunderlich, dass viele Cluster-Initiativen in Baden-Württemberg an Wirtschafts- förderungsinstitutionen (und auch IHKs) angesiedelt sind bzw. von diesen unterstützt werden. In der Vergangenheit haben die Cluster-Initiativen primär Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft unterstützt. Die damit verbundenen Dienstleistungen und Services spiegeln oftmals die gesamte Breite der Bedarfe dieser Kundengruppe wider (Networking, Matching, Aus- und Weiterbildung, Arbeitsgruppen, Cross-Clustering, Tech- nologietransfer, Internationalisierung etc.). Cluster-Initi- ativen stellen aber auch geeignete Instrumente dar, die von Wirtschaftsförderern und anderen regionalen Ak- teuren im Kontext regionalpolitischer Strategieprozesse genutzt werden können. Somit repräsentiert eine Clus- ter-Initiative in der Regel eine Teilmenge an Akteuren ei- ner Region. In Baden-Württemberg haben Cluster-Initiati- 11 Lämmer-Gamp, Thomas, Meier zu Köcker, Gerd: “Clusters are Individuals. New Findings from the European Cluster Management and Cluster Program Benchmarking”, Copenhagen, Berlin, 2012.
- 13. 11Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Wesentliche Akteure eines regionalen Innovationsstrategie-Prozesses Abbildung 7: Leistungen, die Cluster-Initiativen bzw. deren Managements im Kontext regionaler Entwicklungskonzepte erbringen (250 befragte Akteure aus 25 Regionen; Mehrfachnennungen möglich, Befragungszeitraum 2016 / 2017)13 Kernakteur bei der Erarbeitung der Entwicklungsstrategie Aktives Mitwirken in Strategiesitzung Erarbeitung von Strategie- oder Diskussionspapieren Teilnahme an Strategie-Workshops Nominierung von Experten aus der Cluster-Initiative kleine fachliche Beiträge auf Nachfrage 100 %60 % 80 %40 %0 % 20 % 12 Regionaler Cluster-Atlas Baden-Württemberg 2016, https://www.clusterportal-bw.de/clusterdaten/cluster-atlas-baden-wuerttemberg/. 13 Meier zu Köcker, Gerd; Dermastia, Mateja; Keller, Michael, (2017) “StressTesting Regional Approaches Conducive to Implement S3 through Clusters”, Synthesis Report, DOI: 10.23776/001. ven durchschnittlich rund 60 Mitglieder12 . Des Weiteren haben sie oftmals Erfahrungen in Bezug auf Strategieent- wicklung in ähnlichen Kontexten, da eine Clusterstrategie immer eine regionale, mitgliederbezogene Komponente beinhaltet. Abbildung 6 zeigt die Ähnlichkeit von Cluster-, Unternehmens- und Regionalstrategien. Wie mögliche Unterstützungsleistungen von Cluster-Initi- ativen bzw. deren Clustermanagements für Wirtschafts- förderer und andere regionale Akteure im Kontext der Erarbeitung eines regionalen Entwicklungskonzeptes aussehen und in welcher Intensität diese nachgefragt werden, zeigt Abbildung 7. Zu diesem Thema wurden rund 250 Akteure aus 25 Regionen (Clustermanager/-in- nen, Wirtschaftsförderer, Kammern und andere Interme- diäre) in ganz Europa befragt. Auch wenn diese Ergebnis- se nicht alle Regionen Europas repräsentieren, so zeigen sie doch, dass Cluster-Initiativen oftmals bei der Entwick- lung von regionalen Innovationsstrategien eingebunden werden. Neben der Bereitstellung von Fachexpertise nehmen sie oftmals eine aktive Rolle im Strategieprozess ein.
- 14. 12 Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Neue Instrumente für die Entwicklung regionaler Innovationsstrategien unter Einbindung von Cluster-Initiativen 4 Neue Instrumente für die Entwicklung regionaler Innovations- strategien unter Einbindung von Cluster-Initiativen Akteure (regionale Treiber), die regionale Innovationsstra- tegien erarbeiten oder aktualisieren möchten, stellen sich oftmals die Frage, welche Instrumente anzuwenden und wie Cluster-Initiativen als Instrument eingebunden wer- den können. Der klassische analytische Ansatz, der auf der Auswertung von Regional- und Branchenstatistiken basiert, dürfte allein sicherlich nicht ausreichend sein, da die relevanten Sektoren in der Regel wenig praxisnah ab- bildbar sind und die zugrundeliegende Statistik die Ver- gangenheit betrachtet und weniger die Zukunft. Im Folgenden werden verschiedene neuartige Instru- mente darstellt, die speziell für die Analyse, Erarbeitung und Umsetzung einer regionalen Entwicklungsstrategie eingesetzt werden können (Abbildung 8). Hierbei können zwei wesentliche Kategorien unterschieden werden. Die einen fokussieren sich auf die Analyse des Ist-Standes (Identifikation von Stärken und Schwächen der Region), die anderen haben einen mehr vorausschauenden Cha- rakter (Prognose von für die Region relevanten Trends und Entwicklungen). Nachfolgend wird vor allem auf die blauen Instrumente vertiefend eingegangen, da diese einen gewissen Neuig- keitswert haben und es hier der aktiven Einbindung von Cluster-Initiativen bedarf. Die Instrumente „Regionales Cluster-Portfolio“ und „Dashboard Cluster Services“ soll- ten zu Beginn, während der Ist-Analyse (Stärken-Schwä- chen-Analyse), zur Anwendung kommen. Die Instrumen- te „Innovationsausblick“ und „Entrepreneurial Discovery Workshop“ zielen darauf ab, zukünftige, für die Region relevante Trends zu identifizieren. 4.1 Regionales Cluster-Portfolio Zu Beginn der Erarbeitung oder Aktualisierung einer re- gionalen Innovationsstrategie stellt sich für alle aktiv Be- teiligten zumeist die Frage, wie die Startvoraussetzun- gen der Region aussehen. Der Ansatz einer regionalen Innovationsstrategie sollte auf regionalen Stärken, somit also letztlich auf starken Clustern14 basieren. Der Begriff „Stärke“ meint in diesem Zusammenhang sowohl eine Abbildung 8: Instrumente für die Konzeption von regionalen Entwicklungsstrategien, © VDI/VDE-IT Regionales Entwicklungs- konzept Regionale Markt- und Technologietrends prognostizieren Stärken und Schwächen identifizieren International • Innovationsausblick • Entrepreneurial Discovery Workshop • Experteninterviews • Branchenanalyse • Cluster-Potentialchecks • Dashboard Cluster Services • Experteninterviews • Regionales Benchmarking• Internationales Benchmarking Regional 14 Dominique Foray (2015), Opportunities and challenges for regional innovation policy, Routledge, ISBN: 987-1-138-77672-2.
- 15. 13Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Neue Instrumente für die Entwicklung regionaler Innovationsstrategien unter Einbindung von Cluster-Initiativen hohe Agglomeration („kritische Masse“) als auch eine hohe Wettbewerbsfähigkeit der Akteure. Ein wesentli- ches Element einer regionalen Innovationsstrategie ist letztlich auch die Identifikation und Förderung von Innova- tionen an sektoralen Schnittstellen, die in der Regel zwi- schen regionalen Stärken (Cross-Clustering) stattfinden. Gerade bei der Förderung von Innovationen an sektora- len Schnittstellen können Cluster-Initiativen eine wichtige Rolle spielen, um die Akteure im Sinne eines cross-sek- toralen Ansatzes zusammenzubringen. Für die Ausgangs- betrachtung der Stärken und Schwächen einer Region ist es daher wichtig zu wissen, welches die regionalen Stärken (Cluster) sind und ob es ausreichend entwickelte Akteure gibt, die Innovations- bzw. Transformationspro- zesse initiieren können (z. B. Cluster-Initiativen). Die Betrachtung eines regionalen Cluster-Portfolios bildet hierfür eine gute Grundlage. Konkret werden die Stärken von Clustern und die Exzellenz von Cluster-Initiativen ge- messen und gegenübergestellt, um damit im nächsten Schritt ein regionales Cluster-Portfolio zu erstellen. Die Messung der Stärke der Cluster einer Region kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Wichtig ist hierbei, die Cluster und deren Sektoren realistisch abzu- bilden. Eine gute Möglichkeit ist die Anwendung der Me- thodik des European Cluster Observatory, basierend auf einem errechneten Clusterstärke-Index15 . Dieser Index wird anhand der Multiplikation der räumlichen Spezialisie- rung16 , der räumlichen Konzentration17 , der Produktivität und dem Kehrwert der relativen durchschnittlichen Be- triebsgröße18 bestimmt. Durch diese Berechnung wird u. a. auch berücksichtigt, wie viele Unternehmen es in einem Cluster innerhalb der Region gibt und nicht nur wie hoch die Beschäftig- tenzahlen sind. Über das European Cluster Observatory wurde der Cluster-Index für 51 Cluster oder Gruppen von thematisch zusammenhängenden Wirtschaftszweigen (4-Steller NACE-Codes) in 212 europäischen Regionen (NUTS 2) errechnet. Um eine Veranschaulichung bei die- ser Menge an Daten zu ermöglichen, werden Schwellen- werte festgesetzt. Durch diese können je Cluster 0 bis 4 Stärkepunkte vergeben werden (siehe X-Achse in Abbil- dung 9). Außerdem werden von den 51 möglichen Clus- tern im Portfolio einer Region nur jene abgebildet, die in der Bewertungsskala mindestens einen Stärkepunkt oder mehr erreicht haben. Cluster, die Cluster-Index-Wer- te unterhalb dieses Grenzwertes erreichen, werden nur dann dargestellt, wenn dazu eine Cluster-Initiative in der Region existiert oder wenn die Cluster bisher regional als gefühlte Stärke angesehen werden. Falls möglich wird auch empfohlen, weitere Quellen heranzuziehen und nicht ausschließlich auf die Daten des European Cluster Observatory zurückzugreifen. In Baden-Württemberg wurde dies zum Beispiel mit der BAK-Baselstudie19 gemacht. Somit wurden über die Da- ten des European Cluster Observatory maximal 2 Stärke- punkte für die Konzentration innerhalb Europas und über BAK-Basel maximal weitere 2 Stärkepunkte für die Kon- zentration innerhalb des Bundeslandes vergeben, womit insgesamt wieder maximal 4 Stärkepunkte je Cluster er- reicht werden konnten. Jede Region kann hier letztlich selbst bestimmen, auf welche Daten sie zurückgreifen will, ob ggf. bestehende Studien genutzt oder extra re- präsentative Studien durchgeführt werden, um die Clus- ter-Stärke zu ermitteln. Zur Messung der Exzellenz von Cluster-Initiativen kann man den international anerkannten Ansatz der European Cluster Excellence Initiative (ECEI) anwenden20 , im dem rund 30 Exzellenzindikatoren definiert sind. Die folgenden drei Kriterien lassen sich stellvertretend für die Einzelin- dikatoren der ECEI in der Regel einfach durch öffentlich zugängliche Informationen gewinnen. • Anzahl an Mitgliedern: Cluster-Initiativen brauchen eine Mindestanzahl von Clusterakteuren, um eine kritische Masse zu haben. Weiterhin sollte eine gute Mischung zwischen KMU, Großunternehmen, Wis- senschaft und Akteuren der öffentlichen Hand beste- hen. Nach den ECEI-Kriterien sollten mindestens 40 Clusterakteure Mitglied in einer Cluster-Initiative sein. • Kapazität im Clustermanagement: Um sich aus- reichend um die Clusterakteure kümmern und an- spruchsvolle Aktivitäten im Sinne der Clusterakteure 15 European Kommission; European Cluster Panorama 2016, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20381. 16 Räumliche Spezialisierung = Anteil der Beschäftigten des Clusters in der Region / Anteil der Beschäftigten des Clusters im Referenzraum. 17 Räumliche Konzentration = (Beschäftige des Clusters in der Region / Fläche der Region) / (Beschäftigte des Clusters im Referenzraum / Fläche des Referenzraumes). 18 Kehrwert der relativen durchschnittlichen Betriebsgröße = 1 / (Anzahl Beschäftigte des Clusters in der Region / Anzahl der Unternehmen des Clusters in der Region) / (Anzahl Beschäftigte des Clusters im Referenzraum / Anzahl der Unternehmen des Clusters im Referenzraum). 19 Studie „Innovationskraft Baden-Württemberg: Erfassung in Teilregionen des Landes und Beitrag zum Wirtschaftswachstum“, erstellt im Auftrag des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg durch das Forschungsinstitut BAK Basel Economics AG (2011). 20 Weitere Informationen zur European Cluster Excellence Initiative unter: www.cluster-analysis.org.
- 16. 14 Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Neue Instrumente für die Entwicklung regionaler Innovationsstrategien unter Einbindung von Cluster-Initiativen Abbildung 9: Regionales Cluster-Portfolio (mit fiktiven Beispielen) implementieren zu können, braucht es eine an die Anzahl an Clusterakteuren angepasste Kapazität im Clustermanagement. Die ECEI-Kriterien empfehlen ein Verhältnis von 20 bis 30 Clusterakteuren pro volle Personalstelle im Cluster- management. • Existenz eines neutralen, anerkannten Qualitäts labels: Es gibt eine Reihe von Labeln oder Aus- zeichnungen, die darauf schließen lassen, dass das Clustermanagement eine hinreichend hohe Exzellenz besitzt. Dies können die ECEI-Labels sein, aber auch andere nationale Auszeichnungen wie Cluster-Exzel- lenz Baden-Württemberg21 oder die Aufnahme in das Programm „go-cluster“ (BMWi) oder der Spitzenclus- terwettbewerb (BMBF). Auch für die Exzellenz von Cluster-Initiativen wurden ana- log zur Clusterstärke vier Stärkepunkte vergeben22 . Bezogen auf eine Region können die verschiedenen aus- geprägten Clusterstärken und die Leistungsfähigkeit der Cluster-Initiativen anhand eines regionalen Cluster-Port- folios visualisiert werden, wie Abbildung 9 in einem fikti- ven Beispiel zeigt. Die in Abbildung 9 dargestellten Piktogramme repräsen- tieren die Cluster einer Region. Das Auto-Piktogramm steht somit beispielsweise für das Cluster Automotive, der entsprechende Name daneben steht für die relevante Cluster-Initiative (z. B. Auto-Ländle). Kombinationen von Clustern und Cluster-Initiativen, die im Regionalen Clus- ter-Portfolio auf der dunkel blauen Achse liegen, stellen den Idealfall dar. Kombinationen in der oberen rechten Hälfte stehen für starke Cluster (mit drei oder vier Stärkepunkten für das Cluster), die von exzellenten Cluster-Initiativen (drei oder vier Stärkepunkte für die Exzellenz der Cluster-Initiative) unterstützt werden. Im fiktiven Fall in Abbildung 9 sind damit – ganz im Sinne der Smart Specialisation – die Au- tomotive (Pro-E-Auto) und IKT (CyberMuster) aktuelle Stärkefelder der Region. Unter der Berücksichtigung der strukturverändernden Prozesse gilt es nun zu eruieren, inwiefern die beiden Stärkefelder zukünftig einzeln wei- terverfolgt werden oder ob es möglichweise neue über- lappende Themen, wie z. B. autonomes Fahren als neue strategische Schwerpunkte gibt. Wenn dies tatsächlich der Fall ist und eine neue Themensetzung – welche die IKT und Automotive verbindet – für die Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtung innovative Per- spektiven in beiden Clustern darstellt, dann ist ein gro- ßes Potenzial für einen neuen zusätzlichen strategischen Schwerpunt zur intelligenten Spezialisierung in der Regi- on gegeben. Das Regionale Cluster-Portfolio kann somit als gutes In- strument verstanden werden, sich einen Überblick über die in der Region existierenden Stärken (Cluster) und die Leistungsfähigkeit der entsprechenden Cluster-Initiativen zu schaffen. Es richtet sich nicht nur an die regionalen Träger, die das Zusammenspiel der CI in der Region op- timieren möchten, sondern auch an regionale Akteure, die in der Verschränkung der Kompetenzfelder etablierter Cluster unter Berücksichtigung neuer Trends Innovations- potenziale erkennen wollen. Somit sollte das Regionale Cluster-Portfolio von den Akteuren, die eine regionale In- novationsstrategie vorantreiben, als eines von mehreren analytischen Instrumenten genutzt werden. 21 Weitere Informationen unter: https://www.clusterportal-bw.de/cluster-exzellenz/cluster-exzellenz-baden-wuerttemberg/. 22 Jeweils ein Stärkepunkt für die kritische Masse der Cluster-Initiative und Personalausstattung des Clustermanagements sowie bis zu zwei je nach Güte des Qualitätslabels (ECEI-Silver oder „go-cluster“ ein Stärkepunkt bzw. Cluster-Exzellenz BW oder ECEI-Gold oder Spitzencluster zwei Stärkepunkte). 3 42 Capacity (Leistungsvermögen) der Cluster-Initiative Potenzial(Agglomeration)derregionalenCluster Environ- ment-ML 0 4 3 2 1 0 1 Auto-Ländle BIO ABC Cyber Master Pro-E-Auto Minimum Optimum Pack-Ein & Aus Schwaben- Food
- 17. 15Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Neue Instrumente für die Entwicklung regionaler Innovationsstrategien unter Einbindung von Cluster-Initiativen Abbildung 10: Beispielhafte Darstellung eines Dashboard Cluster-Services Standortorientiert langfristig UMSETZUNG kurzfristig Verwaltung / Wirtschaftsförderung FINANZIERUNG Mitglieder Standort- und Unternehmensorientiert Unternehmensorientiert Infrastruktur Neuansiedlung Gründerförderung Bestandspflege / -entwicklung Standortentwicklung Mapping Firmenbesuche Stammtische Informationsveranstaltungen Vernetzung Matching: International Cross-Clustering Matching: Intra-Sektor Matching: Intra-Cluster Business Development Generierung von Inventionen Generierung von Projektideen Wissensgenerierung Identifizierung von neuen Themen Betriebliche Weiterbildung / Qualifizierung Mitgliederkompetenz / Qualifizierung Leistungsfähigkeit der Region Curriculum entwickeln (Hochschulen) Strategische Identität / Branding / USP Ausbildung (Facharbeiter)Akquise neuer Fachkräfte Leistungsfähigkeit des Netzwerks Neue Produkte / Technologien / Dienstleistungen / Geschäftsmodelle Fachkräfte / Human Resources Sichtbarkeit / Marketing / Public Relation Kooperations- / Innovations- projekte 4.2 Dashboard Cluster-Services In den vorherigen Kapiteln wurde dargestellt, dass Clus- ter-Initiativen und deren Clustermanagements bei der Erarbeitung und Implementierung von regionalen Ent- wicklungsprozessen eine wichtige Rolle spielen können. Somit muss auch dem Servicespektrum von Clusterma- nagements eine hohe Bedeutung beigemessen werden. Welche Services bieten Clustermanagements exklusiv ihren Mitgliedern an? Welche können externalisiert wer- den und somit auch anderen Zielgruppen (wie z. B. Wirt- schaftsförderern oder Kammern) angeboten werden, die zugleich eine synergetische Wirkung in Hinblick auf die Regionalentwicklung entfalten können? Welche zielen be- wusst auf die Entwicklung von Regionen ab (z. B. Stand- ort-Marketing, Regional Branding oder Roadmapping)? Zur Veranschaulichung der Aufgabenfelder und Dienst- leistungen von Clustermanagements hilft die systemati- sche Darstellung des Servicespektrums von Cluster-Initi- ativen mit dem „Dashboard Cluster-Services“ (Abbildung 10). Darin werden drei grundsätzliche Zielrichtungen (standortorientiert, unternehmensorientiert, standort- und unternehmensorientiert) unterschieden, nach denen Clustermanagements ihre Aufgaben definieren können. Im unternehmensorientierten Bereich (dunkelbaue Fel- der, rechts in der Abbildung 10) werden alle möglichen Leistungen einer Cluster-Initiative dargestellt, die darauf abzielen, einen direkten Nutzen bei den Mitgliedsunter- nehmen zu erzeugen. Dieser Bereich umfasst das kom- plette Servicefeld „Business Development“ mit seinen vier Maßnahmen sowie Aufgabenfelder aus drei wei- teren Servicefeldern, nämlich Marketingaktivitäten zur Sichtbarmachung der Mitgliederkompetenzen, Aus- und Weiterbildungsangebote im Bereich „Fachkräfte / HR“ und die Identifizierung von neuen Themen bis zur Gene- rierung von Inventionen. Die Dienstleistungen mit Standortorientierung (hellblaue Felder, links in der Abbildung 10) sind diejenigen, welche im Kontext der Regionalentwicklung und Umsetzung von einer regionalen Entwicklungsstrategie besonders inter- essant sind.
- 18. 16 Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Neue Instrumente für die Entwicklung regionaler Innovationsstrategien unter Einbindung von Cluster-Initiativen In der Mitte der Abbildung 10 finden sich die Aufga- ben und Services, die sowohl unternehmens- als auch standortorientiert sind. Das Servicefeld „Vernetzung“ beispielsweise zielt selbstverständlich darauf ab, den Unternehmen einen Mehrwert zu bieten. Im Sinne der Clustertheorie geht man jedoch davon aus, dass Vorteile insbesondere durch die geographische Nähe und Ballung der Akteure von Bedeutung sind und somit eine Standor- torientierung hinzukommt. Das Servicefeld „Fachkräfte / HR“ kann einen Standortbezug haben und wie die Maß- nahmen Akquise und Curriculum eine Entwicklung auf- zeigen (auch hier werden Wirtschaftsförderungsorganisa- tionen vielfach tätig). Es besteht jedoch immer auch eine starke Unternehmensorientierung im Bereich Fachkräfte, sodass es nie die alleinige Standortorientierung besitzt. Im Servicefeld „Neue Produkte / Technologien / Dienst- leistungen / Geschäftsmodelle“ ist insbesondere dann ein Standortbezug gegeben, wenn es um die konkreten Projekte und deren Umsetzung geht, solche Projekte kön- nen teilweise auch mit Landes-, Bundes- oder EU-Mitteln gefördert werden, wenn sie im entsprechenden Gebiet liegen. Das Servicefeld „Sichtbarkeit / Marketing / PR“ ist das einzige, welches in allen drei Zielrichtungen ver- ortet werden kann. Hinter der Maßnahme „Leistungsfä- higkeit der Region“ sind Standortmarketingmaßnahmen zu verstehen, die klar standortorientiert sind. Die Darstel- lung der Mitgliederkompetenz, welche beispielsweise in Kompetenzatlanten o. ä. Broschüren erfolgt, stellt hinge- gen wieder einen expliziten Nutzen für die Mitglieder dar. Dazwischen liegen Maßnahmen, z. B. Branding / USP, die eine verknüpfte Zielrichtung (Richtung Unternehmen und Standort) haben. Das Dashboard hilft damit zu Beginn des Prozesses der Erarbeitung einer regionalen Innovationsstrategie den be- teiligten Akteuren zu verdeutlichen, welche Aufgabenbe- reiche durch Cluster-Initiativen bereits abgedeckt werden und welche davon unternehmensorientiert, standortori- entiert oder beides sind. Es zeigt aber auch, wo eventuell noch „weiße Flecken“ im Serviceportfolio der Cluster-In- itiativen existieren, die für eine spätere Umsetzung von regionalen Entwicklungsstrategien von Relevanz sind. 4.3 Innovationsausblick Das Instrument „Innovationsausblick“ zielt auf die Identi- fikation von wichtigen zukünftigen Innovationstrends und -themen, die für die Region von Relevanz sind. Dieser Ansatz basiert auf der Annahme, dass die Innovationsak- teure einer Region, die heute besonders aktiv im Bereich der angewandten (marktnahen) Forschung agieren, auch zukünftig durch innovative Produkte, Technologien und Dienstleistungen die Markt- und Technologieführerschaft erreichen können. Damit repräsentieren und bilden sie das Wachstums- und Innovationspotenzial von morgen, insbesondere dann, wenn die regionalen Industriestruk- turen und die Rahmenbedingungen für Forschung, Bil- dung und Innovation günstig sind. Dort, wo Akteure im Bereich der angewandten Forschung besonders aktiv sind, sind zukünftig besonders hohe Wachstums- und In- novationspotenziale zu erwarten. Der Innovationsausblick zeigt, in welchen Innovations- projekten die Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft in einer Region aktiv sind. Mit dieser Methode lassen sich Innovationsthemen und Akteure bestimmen, die eindeutige Hinweise auf die zukünftigen wirtschaftlichen Schwerpunkte einer Region geben. Als Datengrundlagen werden die laufenden, seitens der Bundesregierung ge- förderten FuE- und Innovationsprojekte verwendet, die sowohl mit öffentlichen Mitteln als auch mit Unterneh- Abbildung 11: Innovationsausblick für Regionen in Baden-Württemberg am Beispiel des Innovationsfeldes Erneuerbare Energien (Datenbasis: Förderka- talog des Bundes; laufende Vorhaben), © VDI/VDE-IT FuE-Exzellenz-Index (Materialwirtschaft))
- 19. 17Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Neue Instrumente für die Entwicklung regionaler Innovationsstrategien unter Einbindung von Cluster-Initiativen mensgeldern finanziert werden. Diese Projekte basieren auf bundesweiten Ausschreibungen, wobei die besten Konzepte gefördert werden. Sind Unternehmen und Forschungseinrichtungen einer Region in einem bestimmten Innovationsthema beson- ders aktiv, d. h., es werden besonders viele Projekte sei- tens des Bundes gefördert, bedeutet dies, dass sowohl die Forschungs- und Innovationsexzellenz in diesem The- menfeld besonders hoch ist (da die Projekte immer im bundesweiten Wettbewerb stehen) als auch, dass viele Akteure aus einer Region in diesem Themenfeld aktiv sind. Beides ist für eine regionale Entwicklungsstrategie ein wichtiger Hinweis, da sich in diesem Themenfeld zu- künftig ein regionales Stärkefeld ergeben könnte, das im Kontext einer regionalen Innovationsstrategie entspre- chend berücksichtigt werden sollte. Ist eine Region in einem Innovationsfeld im FuE-Kontext wenig aktiv, wel- che aber als aktuelles regionales Stärkefeld identifiziert wurde, kann der Innovationsausblick frühzeitig mögliche Fehlentwicklungen aufzeigen. Die regionale Innovations- strategie kann diese Problematik aufgreifen und somit frühzeitige „Gegenmaßnahmen“ identifizieren. Abbildung 12: Relative Stärke der Region Nordschwarzwald im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, basierend auf dem Instrument des Innovationsausblicks (Datenbasis: Förderkatalog des Bundes; laufende Vorhaben, normiert), © VDI/VDE-IT Produktionstechnologien Klima, Klimaschutz; Globaler Wandel Sonstiges (Innovationsrelevante Rahmenbedingungen und übrige Querschnittsaktivitäten) Forschung im Dienstleistungssektor Erneuerbare Energien Ökologie, Naturschutz, nachhaltige Nutzung Werkstofftechnologien Multimedia - Entwicklung konvergenter IKT Demographischer Wandel Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung Kommunikationstechnologien und -dienste Forschung in der Bildung Rationelle Energieumwandlung Zivile Sicherheitsforschung Sonstiges (Förderorganisationen, Umstrukturierung der Forschung im Beitrittsgebiet; Hochschulbau und überwie- gend hochschulbezogene Sonderprogramme) Fahrzeug- und Verkehrstechnologien Forschung zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen Optische Technologien Gesundheitsforschung und Gesundheitswirtschaft Elektronik und Elektroniksysteme Softwaresysteme; Wissenstechnologien 21 1,50,50 Produktion Kreativwirtschaft / IKT Materialwirtschaft Gesundheit
- 20. 18 Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Neue Instrumente für die Entwicklung regionaler Innovationsstrategien unter Einbindung von Cluster-Initiativen Abbildung 11 zeigt ein typisches Ergebnis eines Inno- vationsausblickes am Beispiel des Innovationsfeldes Erneuerbare Energien für Baden-Württemberg. Dunkel blau gefärbten sind besonders aktiv im Bereich der ange- wandten FuE. Die beteiligten Unternehmen investieren gleichzeitig Mittel im signifikanten Umfang, da die geför- derten Projekte zu mindestens 50 % mit privaten Mitteln zu finanzieren sind. Forschungspartner sind ebenfalls in- tensiv involviert. Durch eine Indexierung lässt sich messen, in welchen Innovationsfeldern eine Region im Bundesvergleich über- durchschnittlich stark oder schwach ist. In Abbildung 12 ist dies für die Region Nordschwarzwald veranschaulicht. Werte, die über dem normierten Wert 1 liegen, deuten auf eine hohe relative Stärke im Bundesvergleich hin. So ist im vorliegenden Beispiel die Region Nordschwarzwald im Bereich angewandte FuE in Produktionstechnologien mit einem Indexwert von 2 besonders stark aktiv. Der Innovationsausblick berücksichtigt natürlich nicht alle FuE- bzw. Innovationstätigkeiten der Akteure einer Regi- on. So fehlt die Einbeziehung regionaler Förderprogram- me ebenso wie unternehmensinterne FuE-Tätigkeiten. Dennoch eignet er sich als Indikator oder Trendradar, um einen Eindruck zu bekommen, in welchen Innovations- themen die Akteure einer Region besonders aktiv sind. Er ermöglicht es, Informationen zu konkreten Projektin- halten und beteiligten Unternehmen zu erhalten. Dies ist vor allem dann interessant, wenn solche Unternehmen in einem Themenfeld FuE- und Innovationsaktivitäten durchführen, welches bisher (noch) nicht zum Kerngebiet des Unternehmens gehört. Hierin lassen sich erste Anzei- chen für strukturverändernde Aktivitäten in einer Region erkennen, die im Rahmen einer regionalen Innovations- strategie berücksichtigt werden sollten. Wenn z. B. meh- rere Softwareunternehmen einer Region zunehmend im FuE-Bereich „Energieforschung“ aktiv werden, deutet dies darauf hin, dass verstärkt cross-sektorale Innovati- onen zwischen IKT und Energie ablaufen, in die mehrere Unternehmen signifikant investieren. Zur besseren Interpretation der Ergebnisse des Innova- tionsausblicks sollten diese mit den regionalen Cluster- Portfolios gespiegelt werden, um zu erkennen, in wel- chen Bereichen existierende Cluster-Initiativen diese Trends konkret aufnehmen können bzw. wo eher signi- fikante Transformationsprozesse auf existierende Clus- ter-Initiativen zukommen. 4.4 Entrepreneurial Discovery Workshop Ein wichtiger Schritt bei der Erarbeitung einer regiona- len Innovationsstrategie ist die Identifikation zukünftiger Trends, die für eine Region von Bedeutung sind. Hierbei sind nicht allgemeine Trends wie Digitalisierung, Elekt- romobilität oder Demographischer Wandel gemeint. Vielmehr geht es um konkrete, für die Region relevante Trends, vor allem auch solche, die einen strukturverän- dernden Charakter für die Region haben. Diese struk- turverändernden Prozesse in einer Region gilt es zu identifizieren und darauf aufbauend die strategischen Schwerpunkte zu setzen. Der sog. Entrepreneurial Discovery Workshop (EDW) ist hierbei ein geeignetes Instrument, genau diese struk- turverändernden Prozesse zu identifizieren. Grundlagen des EDW sind die innovationsrelevanten Stärkefelder (Cluster), welche eine Region auszeichnen. Basierend auf diesen Stärken und unter Berücksichtigung relevan- ter Innovationstrends besteht das Ziel des EDW darin, die strukturverändernden Prozesse (transformative ac- tivities) zu identifizieren, die für die Unternehmen und Forschungseinrichtungen, und damit auch für die Region, von besonders großer Relevanz sind. In Kenntnis dieser strukturverändernden Prozesse können dann zukünftig regionale Entwicklungspotenziale und damit verbundene Maßnahmen abgeleitet werden. Neben dem analytischen Input aus der Analysephase (z. B. Stärken-Schwächen- analyse, regionales Cluster-Portfolio und Innovationsaus- blick) ist die Einbindung der Cluster-Initiativen (vertreten durch die entsprechenden Clustermanagements) der Region von besonderer Wichtigkeit. Die Clustermanage- ments als Vertreter von Wirtschaft und Wissenschaft der Region haben in der Regel ein gutes Markt- und Tech- nologiewissen, da sie sich mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigen, wenn diese in ihren Cluster-Initiativen Ak- tivitäten (z. B. Innovationsförderung, Technologietransfer oder Cross-Clustering etc.) durchführen. Sie vertreten somit nicht die Interessen eines Unterneh- mens oder das Forschungsfeld einer Wissenschaftsor- ganisation, sondern als neutraler Akteur die Vielzahl der Interessen der Mitglieder der betreffenden Cluster-Ini- tiative. Vor dem Hintergrund wird auch die Wichtigkeit eines exzellenten und leistungsfähigen Clustermanage- ments deutlich. Das notwendige Wissen, welches die Clustermanagements im Rahmen des EDW einbringen, erlangen sie in der Regel durch die enge Zusammenar- beit mit ihren Mitgliedern. Am EDW nehmen in der Regel 10 bis 20 Akteure teil.
- 21. 19Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Neue Instrumente für die Entwicklung regionaler Innovationsstrategien unter Einbindung von Cluster-Initiativen Gesundheit Produk/on Werkstoffe IKT Adap%ve Fer%gung Addi%ve Fer%gung Service Robo%k Medizintechnischer Produkte Pflege-Robo%k Abbildung 13: Beispielhafte Darstellung eines Synergie Diamanten als Kernelement für einen Entrepreneurial Discovery Workshop, © s3-4AlpClusters, VDI/VDE-IT Wichtig ist es, dass betreffende „Suchfeld“ zu fokus- sieren, um die für die Region relevanten Ergebnisse zu erreichen. Dies kann dadurch erreicht werden, dass man sich im Rahmen des EDW bewusst auf die wirklichen re- gionalen Stärkefelder konzentriert. Bei den identifizierten Trends bzw. strukturverändernden Prozessen, die zwi- schen diesen regionalen Stärkefeldern ablaufen, dürfte die Region (aufgrund der Stärkefelder) auch eine gute Ausgangsposition haben, vor allem dann, wenn die regi- onale Entwicklungsstrategie langfristige, unterstützende Rahmenbedingungen setzt. Eine bewährte Methodik, die während des EDW gut an- gewendet werden kann, ist der sog. Synergie Diamant (Synergy Diamond). Ausgehend von in der Regel vier oder fünf regionalen Stärkefeldern werden gemeinsam mit den Teilnehmer/-innen des EDW die strukturverän- dernden Prozesse zwischen den Stärkefeldern identifi- ziert. So zeigt die Praxis, dass diese strukturverändernden Pro- zesse bzw. Trends in der Regel von zwei Stärkefeldern ausgehen (z. B. transformiert eHealth von Gesundheits- bereich und von IKT aus; 3D-Druck für medizintechnische Produkte transformiert von additiven Fertigungsverfah- ren und der Medizintechnik). Wenn man daher vier Stär- kefelder einer Region als Ausgangsbasis nimmt, kann der EDW die strukturverändernden Prozesse einer Region genau zwischen diesen Stärkefeldern identifizieren. Ein Beispiel ist in Abbildung 13 dargestellt. Die Ecken des Diamanten entsprechen den vorher identifizierten Stär- kefeldern einer Region. Die für die Region relevanten strukturverändernden Prozesse (regionale Trends) sind auf den Kanten zwischen zwei Stärkefeldern widergege- ben. Das heißt, sie ergeben sich im Zusammenspiel der vorhandenen Stärkefelder.
- 22. 20 Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Erfolgversprechende Ansätze zur Nutzung von Cluster-Initiativen im Kontext regionaler Innovationsstrategien 5 Erfolgversprechende Ansätze zur Nutzung von Cluster- Initiativen im Kontext regionaler Innovationsstrategien Jede Region hat eigene individuelle Voraussetzungen, Strukturen und Ansätze zur Konzeption und Umsetzung regionaler Innovationsstrategien. Dies gilt auch im Hin- blick darauf, wie und in welchem Maße Cluster-Initiati- ven hierbei eingebunden werden. Somit ist ein direkter Vergleich zwischen Regionen bedenklich. Trotz der un- terschiedlichen Voraussetzungen, jeweiligen Verfasstheit und der damit verbundenen sehr verschiedenen Aktions- spielräume zeigen die gewählten Beispiele in diesem Kapitel sehr interessante Ansätze und Methodiken im Kontext der Regionalentwicklung, die zu einem gewissen Anteil gegebenenfalls auch in zukünftigen regionalen In- novationsstrategien berücksichtigt werden könnten. Der Schwerpunkt liegt bei den folgenden Beispielen vor allem auch darauf, wie Cluster-Initiativen bei der Entwicklung und Implementierung von regionalen Innovationsstrate- gien eingebunden waren und welche Rolle sie spielten. 5.1 Baden-Württemberg Im Rahmen von RegionWIN wurde in Baden-Württem- berg eine Vielzahl von guten Ansätzen zur Regionalent- wicklung geschaffen. Die beiden folgenden Beispiele zei- gen ergänzende Ansätze, stellvertretend für eine Reihe von weiteren interessanten Konzepten in Baden-Würt- temberg. Region Mannheim / Rhein-Neckar Schwarzwald- Baar-Heuberg Hamburg Bozen-Südtirol Süddänemark (Syddanmark) Einwohner: 325.000 (Stadt) 2,3 Mio. (Me- tropolregion Rhein-Neckar) 481.000 1,7 Mio. (Stadt- staat); 5,3 Mio. (Me- tropolregion Hamburg) 520.000 1,2 Mio. Regionaler Treiber (Akteurs form), Sitz: Stadt Mannheim (Kommunal- verwaltung), Mannheim IHK Schwarz- wald-Baar-Heu- berg, (Kör- perschaft des öffentlichen Rechts), Villin- gen-Schwennin- gen Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (Lan- desverwaltung), Hamburg IDM Südtirol - Alto Adige (Regionale Wirtschaftsför- derung), Bozen Regional Coun- cil of Southern Denmark (Regi- onsverwaltung), Vejle Stärkefelder (Anzahl und Auflistung: 4: • Medizin technologie • Kultur- und Kreativ wirtschaft • Energie und Umwelt • Produktions- technologie 4: • Medizin technik • Mikrotechnik • Kunststoff- technik • Zerspanungs- technik 8: • Erneuerbare Energien • Medien/IT • Kreativ wirtschaft • Life Science • Logistik • Luftfahrt • Maritime Wirt- schaft • Gesundheits- wirtschaft 6: • Alpine Sicherheit • Bauwesen • Gesundheit • Health & Well- ness • Lebens- mittel- produktion • Sport & Win- tertechnologie 4: • Cleantech • Design • Gesundheits technologien • Windenergie
- 23. 21Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Erfolgversprechende Ansätze zur Nutzung von Cluster-Initiativen im Kontext regionaler Innovationsstrategien Region Mannheim / Rhein-Neckar Schwarzwald- Baar-Heuberg Hamburg Bozen-Südtirol Süddänemark (Syddanmark) Organisations- struktur zum Cluster- / Stär- kefeldmanage- ment: Die 4 Stärke- felder sind als Cluster-Initia- tiven bei der kommunalen Wirtschaftsför- derung verortet. Der Verein Technology Mountains e.V. agiert als Dach für 3 Cluster- Initativen. Die Cluster-Ini- tiativen haben eine Vereins- oder GmbH- Struktur. Zu den Stärke- feldern: Es gibt die folgenden Cluster in HH: • Erneuerbare Energien • Medien/IT • Kreativwirt- schaft • Life Science • Logistik • Luftfahrt • Maritime Wirt- schaft • Gesundheits- wirtschaft Die Ecosystems sind direkt ohne eigene Rechtsform bei der IDM (als regionale Wirtschafts- förderung) angesiedelt. Sie repräsentieren die Stärkefel- der Südtirols und setzen die Inhalte der S3 in enger Abstimmung mit dem Land Südtirol und der Handelskammer Bozen um. Cluster-Initiati- ven agieren als Koordinator re- gionaler Koope- rationsmodelle für Innovation zur Umsetzung der S3 ,die Cluster-Initi- ativen sind organisatorisch unabhängig vom Regional Council. Besonderheit: Cluster-Initiati- ven und deren Managements sind das we- sentliche strate- gisches Element der Regional- entwicklung, es gibt keine Mit- gliedsbeiträge (durch Verwal- tung finanziert), in der Region gibt es weitere Cluster, die von anderen Akteu- ren gemanagt werden. Cross-sekto- raler Ansatz mit Fokus auf Technologie, unternehmens- getrieben, ca. 300 Mitglieder, die automatisch allen Cluster-Ini- tiativen ange- hören. Erste Projekte zur Re- gionalentwick- lung entstehen derzeit. Cluster-Initi- ativen reprä- sentieren die Stärkefelder der Stadt Hamburg und setzen die Inhalte der S3 in enger Abstim- mung mit der Hamburger Wirtschafts- behörde um. Mit dem ver- gleichsweise neuen Ansatz des „Ecosys- tems“ sollen auch Akteure seitens der IDM unterstützt werden, die sich (noch) nicht für eine konkrete, verbindliche Clusterarbeit im Rahmen einer der sechs Stärkefelder entschieden haben. Die besondere Position des Regional Coun- cil of Southern Denmark gibt diesem eine zentrale Rolle bei der Entwick- lung und Im- plementierung der S3. Alle 4 Cluster-Initiati- ven haben ein ECEI-Gold-La- bel. Abbildung 14: Gegenüberstellungen der Beispielregionen
- 24. 22 Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Erfolgversprechende Ansätze zur Nutzung von Cluster-Initiativen im Kontext regionaler Innovationsstrategien 5.1.1 Smarte Clusterentwicklung in Mannheim – Integrierter Ansatz der kommunalen Wirtschaftsförderung Vom Gemeinderat der Stadt Mannheim wurde im Jahr 2009 / 2010 als wirtschaftspolitische Strategie für Mann- heim der Fokus auf vier Stärkefelder beschlossen. Auf deren Entwicklung hat sich die städtische Wirtschafts- förderung Mannheim in den vergangenen Jahren kon- zentriert. Die Aufgabenstellung, welche bis heute für die vier Cluster (Kultur- und Kreativwirtschaft, Energie und Umwelt, Produktionstechnologie und Medizintechno- logie) besteht, lautet: Ausbau der Vernetzung mit virtu- eller und realer Infrastruktur zu einem neuartigen Inno- vationsökosystem. Alle vier Cluster sind räumlich nicht auf die Stadt Mannheim begrenzt, sondern schließen die Akteure der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar ein, um Zukunftstechnologien und Kreativität in der Region zu stärken. Durch enge Verknüpfung von Wissenschaft und Unternehmen sollen die Stärkefelder unterstützt und durch entsprechende Cluster-Initiativen weiterentwickelt werden. Die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen ist dabei ein Kernpunkt des Engagements der Wirt- schaftsförderung23 . Folgende Punkte sind bei diesem Ansatz bemerkenswert: • Die Wirtschaftsförderung Mannheim hat eine kon- krete regionale wirtschafts- und innovationspolitische Strategie entwickelt, die politisch legitimiert ist und konsequent umgesetzt wird. Region: Mannheim (Metropolregion Rhein-Neckar) Einwohner: 325.000 (Stadt), 2.3 Mio. (Metropolregi- on Rhein-Neckar) Stärkefelder / Cluster im Fokus: 4 Cluster: Medizin- technologie, Kultur- und Kreativwirtschaft, Energie und Umwelt, Produktionstechnologie Rolle der Cluster-Initiativen im Kontext der regiona- len Wirtschaftsentwicklung: Cluster-Initiativen und deren Clustermanagements sind das wesentliche strategische Element der Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung 23 Dazu: https://www.clusterportal-bw.de/regionen/regionen-detailseite/rhein-neckar/clusterdb/Region/pdftech/. 24 Bordon, Mannheim Medizintechnik Cluster, OECD Workshop “New Cluster Policies”, April 2016, Berlin. Abbildung 15: Integration des Clustermanagements Medizintechnik in die Wirtschaftsförderung und regionale öffentliche Verwaltung24 Organisatorische Integration ist entscheidend für den notwendigen Stakeholder-Fokus, Ausführung und Tempo Stadtverwaltung Mannheim Universitätsmedizin Mannheim mg:gmbh Bauherr 100% städt. Gesellschaft 100% städt. Gesellschaft Bauherr Export Panel International Business Development Office Industrie-in-Klinik- Plattform (Phase 1) Practice Advisors Projektleitung Projektleitung (Mit-) Antragsteller und Fördermittelempfänger Gesamt projektleitung „Owner“ und Koordinator von Netzwerken / Expertengruppen Cluster Mangt.
- 25. 23Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Erfolgversprechende Ansätze zur Nutzung von Cluster-Initiativen im Kontext regionaler Innovationsstrategien • Es existiert eine klare Fokussierung (Priorisierung) auf wenige, aber bereits existierende Stärkefelder / Cluster. • Obwohl die Finanzierung bzw. Bereitstellung der Clus- termanagementressourcen durch die Stadt Mannheim erfolgt, wird das Potenzial der ganzen Metropolregion Rhein-Neckar genutzt, welche neben Baden-Würt- temberg auch Teile von Rheinland-Pfalz und Hessen einschließt. • Die Clustermanagements sind Teil der städtischen Wirtschaftsförderung und haben somit exzellenten Zugang zur Stadtverwaltung, außerdem sind sie in die Aktivitäten der regionalen Wirtschaftsförderung eingebunden. Durch diesen Ansatz ist eine effiziente Verzahnung von Forschung und Unternehmen mit der öffentlichen Ver- waltung möglich. Auch andere Aspekte, wie ein ver- bessertes Forschungs- und Arbeitskräfteumfeld für Bestandsunternehmen sowie Start-ups und Neuansied- lungen, können in die Clusterentwicklung in der Region leicht integriert werden (vgl. Abbildung 10, Dashboard Cluster-Services: Standortorientierung). Der konkrete Ansatz der Stadt Mannheim zur Nutzung der Cluster-Initiativen als Instrument der Implementie- rung der regionalen wirtschaftspolitischen Strategie wird am Beispiel des Clusters Medizintechnik Mannheim nachfolgend erklärt. Das Ziel für die Cluster-Initiative Medizintechnik ist es, Akteure aus Industrie, Klinik, For- schung und Technik gemeinsam • an einem Ort • Medizinprodukte schneller und effizienter sowie • konsequent ausgerichtet auf den klinischen Versor- gungsbedarf • zu entwickeln und zu vermarkten. Die organisatorische Integration des Clustermanage- ments in die Wirtschaftsförderung und Stadtverwaltung ist in Abbildung 15 darstellt. Sie zeigt die intensive Ver- zahnung aller wichtigen Stakeholder. In den letzten Jahren hat das Clustermanagement zu- sammen mit der Stadtverwaltung eine Reihe an Pro- jekten akquiriert, die für die Implementierung der wirt- schaftspolitischen Strategie von großer Wichtigkeit sind. Durch die Bündelung von regionalen Investitionen sowie die Akquisitionen auf Landesebene (z. B. das Projekt DE- LIVER – Internationalisierung von KMU durch das Clus- ter Medizintechnologie) als auch auf Bundesebene ist es Abbildung 16: Assistenzsysteme, Medizintechnik
- 26. 24 Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Erfolgversprechende Ansätze zur Nutzung von Cluster-Initiativen im Kontext regionaler Innovationsstrategien der Region Mannheim gelungen, signifikante öffentliche Investitionen zu tätigen. Abbildung 16 zeigt einige Bei- spiele, die den ganzheitlichen Ansatz Mannheims veran- schaulichen. Als ein konkretes Beispiel ist der Gewinn des Forschungscampus-Wettbewerbs „öffentlich-private Partnerschaft für Innovationen“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) in 2012 zu nennen. Hier fördert das BMBF über bis zu 15 Jahre hinweg mit bis zu 30 Millionen Euro das Projekt „Mannheim Mole- cular Intervention Environment“ (M2OLIE) und damit die Entwicklung des „Operationsraums der Zukunft“ in Mannheim. Das Clustermanagement war an der Akquisi- tion federführend beteilig25 . Das ernsthafte und langfristige Commitment der Stadt Mannheim gegenüber seinen Cluster-Initiativen wie dem Cluster Medizintechnologie Mannheim zeigt sich auch darin, dass das Clustermanagement zu 100 % finanziert wird und somit eine klare inhaltliche Konkretisierung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten auf vier Stärkefelder erfolgt. Eine Hebelwirkung und indirekte Erhöhung der städtischen Mittel kommt durch die effektive Fördermit- telakquisition für Projekte im jeweiligen Stärkefeld zu- stande. 5.1.2 Technologieverbund als „Cross-Sektorales- Dach“ in der ländlich geprägten Industrieregion Schwarzwald-Baar-Heuberg Angeregt durch einige innovative Unternehmen und auf Initiative der IHK wurde 2005 in der Region Schwarz- wald-Baar-Heuberg ein Verein gegründet mit der Zielset- zung, die regionalen Schlüsselbranchen Medizintechnik, Mikrotechnik oder Kunststofftechnik zu fördern. Im Jahr 2011 wurde die MedicalMountains AG gegründet, die für die Medizintechnik als Leuchtturmbranche der Regi- on mit internationaler Ausstrahlung tätig ist, sowie das Kunststoff-Institut Südwest GmbH & Co. KG. Gemein- sam mit der Hahn-Schickard-Gesellschaft e. V. wurde im Jahr 2012 der Verein in TechnologyMountains e. V. um- benannt und neuausgerichtet. Der gemeinsame Nenner des unternehmensgetriebenen Technologieverbunds TechnologyMountains e. V. mit sei- nen drei „Sub-Organisationen“ ist es seither, die Innova- tion in Feinwerk- und Präzisionstechnik sowie cross-sek- torale Verbundprojekte durchzuführen. Dabei agiert der TechnologyMountains e. V. als ein Dach, als zentraler An- sprechpartner für seine etwa 250 Mitglieder, der auch die Sichtbarkeit nach außen wahrnimmt und außerdem orga- nisatorisch sowie koordinierend zwischen den einzelnen Stärkefeldern tätig ist. Folgende Punkte sind bei dem Ansatz des Technology- Mountains e. V. bemerkenswert: • Regionaler Treiber ist die IHK Schwarzwald-Baar-Heu- berg, bzw. der von ihr initiierte Technologieverbund des TechnologyMountains e. V. und damit letztendlich eine Cluster-Initiative. • Klare Absprachen zwischen den regionalen Akteuren sorgen für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Themen und Strukturen. So sind die regionale Wirt- schaftsförderungsgesellschaft (die auf die Themen Fachkräfte und Standortmarketing fokussiert ist) und der Regionalverband (der Regionalplanung im klassi- schen Sinn betreibt) beide Mitglieder beim Technolo- gyMountains e. V. und können somit Einfluss nehmen und ihre Kompetenzen fallbezogen einbringen. • Bei neuen Aufgaben, die sich weniger auf reines Clus- termanagment beziehen und mehr in Richtung einer regionalen Wirtschaftsentwicklung gehen, kommt dem TechnologyMountains e. V. zugute, dass er auf ca. 250 engagiert eingebundene Unternehmen zurück- greifen kann. Diese Unternehmen aus allen Stärkefel- dern können bei der Entdeckung strukturverändernder Prozesse und deren Auswirkungen im Sinne eines unternehmerischen Entdeckungsprozesses (Entre- preunerial Discovery Process) eine wichtige Rolle ein- nehmen. Das langjährige Vertrauen untereinander und zu TechnologyMountains e. V., insbesondere durch die cross-sektoralen-Verbundprojekte, wird sich auch Region: Schwarzwald-Baar-Heuberg Einwohner: 481.000 Stärkefelder / Cluster im Fokus: 3 Cluster: Medizin- technik, Mikrotechnik und Kunststofftechnik Rolle der Cluster-Initiativen im Kontext der regio- nalen Wirtschaftsentwicklung: Die Cluster-Initiative TechnologyMountains e. V. nimmt als Cross-Sektora- le-Holding eine Schlüsselfunktion beim Management der Stärkefelder ein. Erste Projekte der regionalen Wirtschaftsentwicklung bzw. S3 sind gerade am Ent- stehen. 25 Siehe hierzu: https://www.mannheim.de/wirtschaft-entwickeln/cluster-medizintechnologie.
- 27. 25Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Erfolgversprechende Ansätze zur Nutzung von Cluster-Initiativen im Kontext regionaler Innovationsstrategien 26 Näheres zu den prämierten Beiträgen der Phase 2 des Landeswettbewerbs RegioWIN: http://regiowin.eu/pramierte-beitrage-phase-2/. 27 Weitere Informationen zum thyssenkrupp Testturm: „Die Zukunft kann beginnen“: http://testturm.thyssenkrupp-elevator.com/2016/12/thyssenkrupp-testturm-die-zukunft- kann-beginnen/ positiv auf die Umsetzung von konkreten Maßnahmen im S3-Prozess auswirken. Mit der erfolgreichen Teilnahme an RegioWIN erhält die Region EFRE-Fördergelder und Landesmittel für zwei RegioWIN-Leuchtturmprojekte, die Teil einer regionalen Entwicklungsstrategie sind. In einem ersten Projekt, dem Forschungs- und Transferzentrum für mikromedizintech- nische Fertigung (Medassembly), ist vorgesehen, dass sich durch die Kombination von medizintechnischer und mikrosystemtechnischer Expertise in Forschung / Ent- wicklung die Dienstleistung und Fertigung im Bereich der miniaturisierten Medizintechnik weiterentwickeln und besser miteinander vernetzen lässt. Dazu soll die vor- handene Fertigungsinfrastruktur der Hahn-Schickard-Ge- sellschaft e. V. erweitert und an das Stärkefeld Medi- zintechnik medizintechnisch angepasst werden. Am Wachstumskern Medizintechnik setzt auch das zweite Leuchtturmprojekt an, der Aufbau eines regionalen Inno- vations- und Forschungs-Zentrums am Hochschulcam- pus Tuttlingen. Das Ziel besteht darin, ein Gebäude zu schaffen, in dem verschiedene Aktivitäten zur Stärkung der Innovationsfähigkeit, insbesondere von kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) der Region aus den Bereichen Medizintechnik, Mikrotechnik, Kunststofftech- nik, Maschinenbau und Produktionstechnik durchgeführt werden. Damit wird eine stärkere Zusammenarbeit zwi- schen Hochschule und regionaler Industrie erreicht und somit das Transfergeschehen gestärkt. Der Fokus liegt auf der Generierung und Begleitung von Innovationspro- zessen, die zu Marktinnovationen und zu Existenzgrün- dungen führen. Zur Erreichung des Ziels, Innovationen und Existenzgründungen in der Region zu stärken, wer- den Start-up-Ideen aus der Hochschule heraus begleitet und Forschungsanfragen an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Wissenschaft koordiniert und durchge- führt26 . Ein ganz anderer „Leuchtturm“ zeigt außerdem weite- re konkrete Zukunftsperspektiven der wirtschaftlichen Entwicklung und einen Ansatz für strukturverändernde Prozesse der Region. Es handelt sich um den 246 Meter hohen Testturm der Firma thyssenkrupp Elevator AG, den Wegbereiter für Innovationen und Transformation der Aufzugsindustrie. Darin ist u. a. ein Mehrkabinen-Auf- zugssystem vorgesehen, welches als Antrieb eine Magnetschwebetechnologie basierend auf dem Prinzip des Transrapids einsetzt. Hochgeschwindigkeitstests sollen durchgeführt und effektivere Transportmöglichkeiten in Gebäuden ebenso erprobt werden wie neue Wartungslösungen, die in com- putergesteuerte Serviceprozesse eingebunden sind.27 Für eine S3-Analyse bedeutet dies, die globalen Mega- trends „Urbanisierung“ und „Digitalisierung“ werden plötzlich für eine ganz gezielte Anwendung – der Auf- zugstechnik – (durch einen unternehmerischen Entde- ckungsprozess) für die Region relevant. Dies bietet Po- tenziale für die bestehenden Stärkefelder, beispielsweise für die Steuerung und Digitalisierung der Aufzugssyste- me mittels Mikroelektronik oder durch die Verwendung von Kunststoffen und metallischen Werkstoffen (Zer- spanung) für neue Aufzugskörbe, bis hin zu einer Mes- sung der Gesundheitszustände und ggf. automatischen Notrufen unter der Verwendung modernster medizin- technischer Analyseverfahren. Um diese Potenziale und weitere strukturverändernde Prozesse zu diskutieren, ist der TechnologyMoutains e. V. aktuell dabei, mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Rottweil ein Konzept von Strategien und Maßnahmen zur Standortentwicklung, z. B. mittels Coworking-Spaces für Zulieferer oder Start- ups, zu erarbeiten. Dies bedeutet, hier kann methodisch mit dem EDW-Ansatz (vgl. Kap. 4.4) ebenso gearbeitet werden wie mit dem Dashboard Cluster-Services (vgl. Kap. 4.1). Neben dem Handlungsfenster Standortent- wicklung zeigt sich auch eine außergewöhnliche Chance für das Servicefeld „Sichtbarkeit / Marketing / PR“. Der Testturm erhält nämlich die höchste Aussichtsplattform Abbildung 17: Testturm der Firma thyssenkrupp Elevator AG in Rottweil, © thyssenkrupp AG
- 28. 26 Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Erfolgversprechende Ansätze zur Nutzung von Cluster-Initiativen im Kontext regionaler Innovationsstrategien Deutschlands und wird außerdem durch die längste Fuß- gänger-Hängebrücke der Welt (600 Meter Länge), wel- che von einem privaten Investor gebaut wird, mit der Alt- stadt von Rottweil verbunden, was zusätzliche Touristen und Aufmerksamkeit anziehen soll. 5.2 Freie und Hansestadt Hamburg Hamburg hat sich das Ziel gesetzt, eine der innovativs- ten Regionen Europas zu werden. Die Clusterpolitik ist auch seit langem als Element der regionalen Wirtschafts- politik verankert. Beides sind Aspekte, die gut vergleich- bar mit dem Ansatz von Baden-Württemberg sind, auch wenn hier der Ansatz eines Stadtstaates mit dem eines Flächenlandes verglichen wird. Gerade der konsequente, neue Cross-Cluster-Ansatz zeigt ein interessantes Kon- zept, welche (neuen) Aufgaben Cluster-Initiativen über- nehmen können. 5.2.1 Hamburg – Cluster-Brücken mit System Hamburg fördert seit vielen Jahren mit aktiver Cluster- politik Innovation, Wachstum und Beschäftigung in zu- kunftsfähigen Wirtschaftsbereichen. Acht erfolgreiche Cluster werden inzwischen unterstützt. Diese Hambur- ger Cluster entsprechen den Stärkefeldern Hamburgs. Die S3 baut direkt auf diesen Clustern und ihren Strategi- en auf. Sie geben der Region ein klares Kompetenzprofil. Der Hamburger Senat begreift Cluster als Instrument der aktiven Wirtschaftspolitik. Das geht weit über klassische Wirtschaftsförderung hinaus. Die Hamburger Wirtschaft ist insbesondere in den clusterpolitisch begleiteten Bran- chen innovationsfähig, wertschöpfungsstark und be- schäftigungsstabil. Folgende Punkte sind beim Hamburger Ansatz bemer- kenswert: • Der Triple-Helix-Ansatz bestehend aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung: Die Hamburger Verwal- tung versteht sich nicht nur als Entscheider und Finan- zier, sondern auch als dauerhafter Partner, Moderator und Impulsgeber. Somit wird sichergestellt, dass die Cluster-Initiativen auch den zukünftigen regionalen He- rausforderungen gerecht werden und die Politik ihre Cluster-Initiativen als Instrument zur Implementierung der S3 nutzen kann. Die Clustermanagements werden als wichtige Ideen- und Impulsgeber für die Clusterpo- litik und regionalen Wirtschaftsförderer gesehen. • Mit Hilfe des Hamburger Benchmarking- und Evalua- tionssystems wurde im Jahre 2011 ein Instrument geschaffen, mit dessen Hilfe die Hamburger Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation die Arbeit der Clustermanagements gut monitoren und Erfolge sicht- bar machen konnte28 . Mit Hilfe dieses Instruments gelingt es, eine gute Kongruenz zwischen den Zielen der Hamburger S3 und der Arbeit der Cluster-Initiati- ven sicherzustellen. • Im Sinne des Smart Specialisation-Ansatzes sollen vor allem an den Schnittstellen zwischen den acht Clus- tern (Stärkefeldern) Innovationen identifiziert werden. Dies soll aber nicht ad hoc wie in vielen anderen Fällen erfolgen, sondern in strategischer Art und Weise, ähn- lich dem Entrepreneurial Discovery Process. Es sollen vor allem dort cross-sektorale Innovationen initiiert werden, wo die betreffende Industrie und Wissen- schaft im Besonderen profitiert. Das Innovations- und Wertschöpfungspotenzial am Standort Hamburg soll in den Überschneidungsfeldern zwischen den Clustern noch besser erschlossen werden. Die Entwicklung dieser Clusterbrücken („cross-clustering“) ist Teil der von der Europäischen Kommission Ende des Jahres 2014 als „Cluster Model Demonstrator Regions“ aus- gewählten Clusterstrategie der Freie und Hansestadt Region: Stadtstaat Hamburg Einwohner: 1.700.000 (Stadt), 5,3 Mio. (Metropol region Hamburg) Stärkefelder / Cluster im Fokus: 8 Cluster (Erneuer- bare Energien, I Medien/IT, Kreativwirtschaft, Life Science, Logistik, Luftfahrt, Maritime Wirtschaft, Ge- sundheitswirtschaft) Rolle der Cluster-Initiativen im Kontext der regio- nalen Wirtschaftsentwicklung: Cluster-Initiativen re- präsentieren die Stärkefelder Hamburgs und setzen die Inhalte der S3 in enger Abstimmung mit der Ham- burger Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovati- on konsequent um. 28 Nähere Informationen unter: http://www.dsn-online.de/fileadmin/user_upload/references-pdf/Eva_BMS_HH_Gutachten.pdf.
- 29. 27Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Erfolgversprechende Ansätze zur Nutzung von Cluster-Initiativen im Kontext regionaler Innovationsstrategien Hamburg (FFH). In der Umsetzung wird die FHH durch das European Cluster Observatory unterstützt und beraten, um zukunftsweisende, branchenübergrei- fende Konzepte zu entwickeln und in der regionalen Clusterpolitik zu verankern. Im Ergebnis konnten 2016 bislang drei vielversprechende Clusterbrückenprojekte begonnen werden. Dies sind die Projekte eHealth, HIHeal – Hygiene, Infection und Health und Co-Lear- ning Space. Das Clusterbrückenprojekt „Hygiene, Infection & Health (HIHeal)“ stellt ein gutes Beispiel für die Umsetzung des Cluster-Brücken-Ansatzes durch zwei Hamburger Clus- ter-Initiativen dar. Ziel der clusterübergreifenden Zusam- menarbeit ist es, gemeinsame Wertschöpfungsketten zwischen den Cluster-Initiativen Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH und Life Science Nord Management GmbH zu etablieren. HIHeal vernetzt am Standort Ham- burg verschiedene Akteure in diesem Bereich, darunter Unternehmen, wissenschaftliche Einrichtungen, Kliniken und Kostenträger. Neben den sog. neuen „emerging deseases“ wie Ebola, EHEC und MERS umfasst das Themenspektrum auch nosokomiale Infektionen (Kran- kenhausinfektionen) mit Herausforderungen wie Antibio- tika-Resistenzen und Hygienemaßnahmen. Übergeordnetes Ziel der beiden Cluster-Initiativen, die gemeinsam die beiden Themengebiete „Hygiene, Infec- tion & Health“ und „eHealth“ unter einem Dach bearbei- ten, ist es, die Innovationskraft nachhaltig zu stärken und die Wertschöpfung clusterübergreifend zu steigern. Die Initiative geht über mehrere Jahre und wird eng durch die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation begleitet. Mit dem Cluster-Brücken-Ansatz wird die Idee des EDW bzw. des Synergie Diamanten (vgl. Kap. 4.4) umgesetzt. Dort, wo zwischen den bestehenden Clustern durch strukturverändernde Prozesse neue Stärkefelder entste- hen, werden diese zu neuen Netzwerken geführt. Un- ter einem Dach der InnovationsAllianz Hamburg sollen in den Stärkefeldern Forschungs- und Innovationsparks (F&I-Parks) etabliert werden. Dabei handelt es sich um großflächige Einrichtungen und Gewerbeflächen für den Technologie- und Wissenstransfer, in denen Wirtschaft und Wissenschaft anwendungsorientiert forschen und entwickeln sollen. Mit den F&I-Parks verfolgt Hamburg auch eine klare Orientierung zur Standortentwicklung (vgl. Kap. 4.2 Dashboard Cluster-Services)29 . 29 Weitere Informationen unter: http://www.hamburg.de/bwvi/innovationsallianz/4612422/innovationsallianz-erfolge/. Abbildung 18: Skyline Hamburg
- 30. 28 Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Erfolgversprechende Ansätze zur Nutzung von Cluster-Initiativen im Kontext regionaler Innovationsstrategien Abbildung 19: Ecosystems und Stärkefelder in Südtirol30 Stärkefeld Alpine Technologies Stärkefeld Natural Treat- ments an Medical Technologies Stärkefeld Green Technologies Stärkefeld Creative Industries Stärkefeld ICT and Automation Stärkefeld Food Technologies Total: 950 Unternehmen IM AUFBAU Ecosystem Health & Wellness 188 Unternehmen Ecosystem Civil Protection & Alpine Safety 100 Unternehmen Ecosystem Constructions 198 Unternehmen Ecosystem Wood 79 Unternehmen Ecosystem Sports & Winter Technologies 40 Unternehmen Ecosystem Food 132 Unternehmen Ecosystem Energy & Envionment 55 Unternehmen Ecosystem Automotive 22 Unternehmen Ecosystem ICT & Automation 136 Unternehmen 5.3 Europäische Regionen Im Folgenden werden zwei Beispiele von leistungsfä- higen europäischen Nachbarregionen dargestellt. Auch diese unterscheiden sich bewusst untereinander, zeigen aber auch wieder interessante Ansätze. 5.3.1 IDM Südtirol – vom Cluster zum regionalen Ecosystem-Ansatz Die autonome Region Südtirol hat die Entwicklung ih- rer S3 genutzt, um sich noch stärker als bisher auf ihre sechs Stärkefelder zu fokussieren. Konsequenter Weise beschreibt die S3 diese Stärkefelder (Cluster) und deren Aufgaben vergleichsweise konkret. Dies ermöglicht es den Ecosystem-Managern (Clustermanagements), diese Region: Autonome Region Südtirol Einwohner: 520.000 Stärkefelder / Cluster im Fokus: 6 Stärkefelder (Al- pine Sicherheit, Bauwesen, Gesundheit, Health & Wellness, Lebensmittelproduktion, Sport & Winter- technologie) Rolle der Cluster-Initiativen im Kontext der regio- nalen Wirtschaftsentwicklung: Die S3 beruht auf 6 Stärkefeldern (Clustern). Zu jedem Stärkefeld gibt es ein bis vier Ecosysteme (Cluster-Initiativen), die die Verbindung von der strategischen zur operativen Umsetzung der S3 bilden. 30 Zur RIS3-Strategie unter: https://www.idm-suedtirol.com/de/innovationsfoerderung/ecosystems.html.
- 31. 29Cluster und Innovationen: Cluster-Initiativen als Innovationstreiber Erfolgversprechende Ansätze zur Nutzung von Cluster-Initiativen im Kontext regionaler Innovationsstrategien Region: Süddänemark / Syddanmark Einwohner: 1.200.000 Stärkefelder / Cluster im Fokus: 4 Cluster (Cleantech, Design, Gesundheitstechnologien und Windenergie) Rolle der Cluster-Initiativen im Kontext der regiona- len Wirtschaftsentwicklung: Cluster-Initiativen agie- ren als Koordinator regionaler Kooperationsmodelle für Innovation zur Umsetzung der S3 konkret gefassten Inhalte und Ziele der S3 direkt im Ta- gesgeschäft umzusetzen. Die Ecosystem-Managements sind unmittelbar in die re- gionale Wirtschaftsförderung IDM Südtirol integriert und elementarer Bestandteil der internen Aufbauorganisati- on. Somit steuert die regionale Wirtschaftsförderung die Arbeit der Initiativen direkt und stellt sicher, dass die Ar- beitsinhalte der Umsetzung der regionalen Innovations- strategie dienen. Gleichzeitig hat die IDM Südtirol seitens der Regionalregierung erhebliche Freiheitsgrade bei der Implementierung und Weiterentwicklung der regionalen Innovationsstrategie. Folgerichtig sieht sich IDM Südtirol daher als wesentlicher Think Tank im Kontext der Regi- onalentwicklung. Durch die integrierten Clustermanage- ments besitzt IDM Südtirol hervorragende Zugänge zur regionalen Wirtschaft und Wissenschaft31 . Folgende Punkte sind bei diesem Ansatz bemerkens- wert: • IDM Südtirol hat eine konkrete regionale wirtschafts- und innovationspolitische Strategie in Form der regio- nalen Innovationsstrategie entwickelt, die konsequent umgesetzt wird. • Aufgrund der Nähe zu Politik, Wissenschaft und Wirtschaft koordinieren die Ecosysteme von der IDM Südtirol die signifikanten innovationsrelevanten Aktivi- täten und Initiativen. • Es existiert eine klare Fokussierung auf wenige, aber bereits existierende Stärkefelder (Cluster), die durch die Ecosysteme unterstützt und soweit möglich gesteuert werden. Die Ecosysteme haben wiederum einen starken cross-sektoralen Charakter bzw. beset- zen neue Themen im Sinne der strukturverändernden Prozesse zur Bildung strategischer Schwerpunkte. • Die Ecosysteme legen viel Wert auf transregionale Kooperationen, um Zugang zu Wissen und Know-how zu erhalten, welches nicht in den entsprechenden Initiativen vorhanden ist. Mit dem regionalen Ecosystem-Ansatz dürfte es der IDM Südtirol gelingen, eine Kooperationsplattform für alle Ak- teure der Region zu etablieren. Für die Unternehmen, die sich dem Thema „Innovation und Kooperation“ etwas unverbindlicher nähern wollen, ist der offene Ecosys- tem-Ansatz, der mehr auf Information, Networking, Com- munity Building, Vermittlung von Fach- und Branchenwis- sen setzt, sicherlich ein interessanter Ansatz. 5.3.2 Süddänemark – Cluster-Initiativen als Koordinator regionaler Kooperationsmodelle Im Kontext der Entwicklung und Implementierung der S3 wurde seitens des Regional Council of Southern Den- mark32 großer Wert darauf gelegt, dass sich die Strategi- en der vier Cluster-Initiativen direkt von der S3 ableiten. Im Rahmen der Jahresplanung definieren die Clusterma- nagements und der Council die Arbeitsschwerpunkte. Somit kann gewährleistet werden, dass die Arbeit der Clustermanagements mit den Zielen und Inhalten der S3 übereinstimmt. Durch einen intensiven Dialog zwischen allen Akteuren sowie ein angepasstes Evaluations- und Monitoringsystem wird auch unterjährig sichergestellt, dass die Ziele erreicht werden. Folgende Punkte sind bei diesem Ansatz bemerkens- wert: • Die besondere Position des Regional Council of Southern Denmark gibt diesem eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Implementierung der S3. • Die S3 wird in sehr enger Kooperation zwischen dem Regional Council und den vier Cluster-Initiativen umge- setzt. Gleichzeitig können die Cluster-Initiativen recht unabhängig vom Regional Council agieren, da diese organisatorisch getrennt sind und nur eine bestimmte Kofinanzierung erhalten. 31 Weitere Informationen auf der IDM Südtirol Webseite unter: http://www.idm-suedtirol.com/de/home.html. 32 Der Regional Council of Southern Denmark vertritt die regionale Regierung und den regionalen Wirtschaftsförderer in einer Institution.
