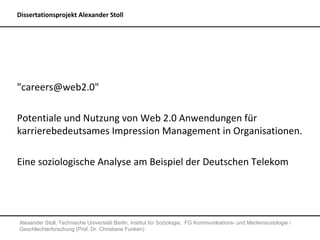
careers@web.20
- 1. Dissertationsprojekt Alexander Stoll "careers@web2.0" Potentiale und Nutzung von Web 2.0 Anwendungen für karrierebedeutsames Impression Management in Organisationen. Eine soziologische Analyse am Beispiel der Deutschen Telekom Alexander Stoll, Technische Universität Berlin, Institut für Soziologie, FG Kommunikations- und Mediensoziologie / Geschlechterforschung (Prof. Dr. Christiane Funken)
- 2. Gliederung Gliederung Hintergrund (I): Wandel von Ökonomie, Organisationen und Arbeit Hintergrund (II): Karrieredeterminanten = Kompetenzen und Netzwerke Theorie (I): Mikroebene Begriffsklärung: Web 2.0 / Social Web / Social Software Theorie (II): Handlung und Struktur Gegenstand: Web 2.0 bei der Deutschen Telekom Fragestellung: Möglichkeiten und Nutzung von Web 2.0 zu für IM Alexander Stoll, Technische Universität Berlin, Institut für Soziologie, FG Kommunikations- und Mediensoziologie / Geschlechterforschung (Prof. Dr. Christiane Funken)
- 3. Hintergrund: Wandel von Ökonomie, Organisationen und Arbeit Von der materiellen zur immateriellen Produktion: Primärer Wertschöpfungsfaktor ist nicht mehr die materielle Produktion, sondern das in Produkten und Dienstleistungen enthaltene Wissen. Wissensarbeit: Die kooperative Verarbeitung und Produktion von Wissen beruht maßgeblich auf Kommunikation. Alexander Stoll, Technische Universität Berlin, Institut für Soziologie, FG Kommunikations- und Mediensoziologie / Geschlechterforschung (Prof. Dr. Christiane Funken)
- 4. Hintergrund: Wandel von Ökonomie, Organisationen und Arbeit Taylorismus: Standortgebundene materielle Produktion in Linienorganisationen Post-Taylorismus: Räumlich verteilte Wissensproduktion in virtualisierten und projektifizierten Matrix-Organisationen Kommunikation findet zunehmend medial vermittelt statt. Alexander Stoll, Technische Universität Berlin, Institut für Soziologie, FG Kommunikations- und Mediensoziologie / Geschlechterforschung (Prof. Dr. Christiane Funken)
- 5. Hintergrund: Wandel von Ökonomie, Organisationen und Arbeit Wissensarbeit: meint die kollektive Produktion von Wissen unter Anwendung und Transformation bestehenden Wissens, das hierbei als permanent verbesserungswürdig und damit revidierbar angesehen wird (vgl. Willke 1998) zielt auf innovative Lösung von spezifischen, komplexen Problemstellungen ist oft in Form von (räumlich verteilten) Projekten organisiert lässt sich nur begrenzt formalisieren benötigt Selbstorganisation besteht hauptsächlich aus (medial vermittelter) Kommunikation Alexander Stoll, Technische Universität Berlin, Institut für Soziologie, FG Kommunikations- und Mediensoziologie / Geschlechterforschung (Prof. Dr. Christiane Funken)
- 6. Hintergrund: Folgen des Wandels von Ökonomie, Organisationen und Arbeit Aus dem Wandel von Organisationen und Arbeit ergeben sich neue Anforderungen an die Beschäftigten. Damit verändern sich auch Karrieredeterminanten. Die Karrieredeterminanten der Wissensökonomie sind: Kompetenzen Netzwerke Alexander Stoll, Technische Universität Berlin, Institut für Soziologie, FG Kommunikations- und Mediensoziologie / Geschlechterforschung (Prof. Dr. Christiane Funken)
- 7. Hintergrund: Karrieredeterminanten Kompetenzen Qualifikationen Kompetenzen Fähigkeiten zur Umsetzung einer Fähigkeiten zur selbstorganisierten Lösung standardisierbaren Aufgabe neuartiger, komplexer Problemstellungen Sind objektiv ausweisbar Sind nicht direkt beobachtbar Sind entpersonalisiert Sind Eigenschaften der Person Alexander Stoll, Technische Universität Berlin, Institut für Soziologie, FG Kommunikations- und Mediensoziologie / Geschlechterforschung (Prof. Dr. Christiane Funken)
- 8. Hintergrund: Karrieredeterminanten Kompetenzen Personalbewertung erfolgt anhand von Kompetenzen. Kompetenzen lassen sich nicht direkt beobachten, sondern ihre Zuschreibung erfolgt anhand beobachteter Performanz. Karriere macht nur, wer Kompetenz "besitzt". Damit wird die persönliche Selbstdarstellung als kompetente Person zur Karrieredeterminante. Besonders wichtig für die eigene Selbstdarstellung sind Face-to-Face-Situationen. Diese sind aber knapp bemessen. Selbstdarstellung muss offline und online erfolgen! Alexander Stoll, Technische Universität Berlin, Institut für Soziologie, FG Kommunikations- und Mediensoziologie / Geschlechterforschung (Prof. Dr. Christiane Funken)
- 9. Hintergrund: Karrieredeterminanten Netzwerke A) Netzwerke als Produktivitätsfaktor Personengebundenes Wissen ist die Ressource der Wissensarbeit. Wissensarbeit findet kooperativ statt; Wissen wird in Interaktionen vermittelt. Persönliche Netzwerke werden zum wichtigen Produktivitätsfaktor, denn sie stellen Wissensressourcen bereit. B) Netzwerke als "Enabler" von Karrieren Personalbewertungen und -entscheidungen werden durch Netzwerkkontakte beeinflusst. Persönliche Netzwerke können Karrieren unterstützen, indem sie Ressourcen bereitstellen (Fürsprache, Informationen, Gefälligkeiten …) Netzwerke stellen Ressourcen bereit, lassen sich als Sozialkapital fassen. Alexander Stoll, Technische Universität Berlin, Institut für Soziologie, FG Kommunikations- und Mediensoziologie / Geschlechterforschung (Prof. Dr. Christiane Funken)
- 10. Theoretischer Zugriff: Mikroebene Impression Management Nach Erving Goffman sind Menschen in Interaktionen stets bemüht, ein bestimmtes, tendenziell positives Bild von sich zu vermitteln. Diesen Vorgang nennt Goffman Impression Management. Performance: „die Gesamttätigkeit eines bestimmten Teilnehmers an einer bestimmten Situation [...], die dazu dient, die anderen Teilnehmer in irgendeiner Weise zu beeinflussen“ (Goffman 1983:18) Das Konzept des Impression Management wird auch im Bereich der Organisationsforschung / Managementtheorie angewandt. Es beschreibt dort die unterschiedlichen Strategien von Mitgliedern einer Organisation, sich (möglichst positiv) darzustellen. Performance wird hier als Gegenbegriff zur Kompetenz genutzt. Alexander Stoll, Technische Universität Berlin, Institut für Soziologie, FG Kommunikations- und Mediensoziologie / Geschlechterforschung (Prof. Dr. Christiane Funken)
- 11. Theoretischer Zugriff: Mikroebene Impression Management als Karrierefaktor Zuschreibung von Kompetenz basiert auf wahrgenommener Performance. Inklusion in Netzwerke und die Bereitstellung von Ressourcen durch Netzwerkkontakte wird durch positiv wahrgenommene Interaktionen begünstigt (kooperatives, authentisches, sympathisches, kompetentes… Verhalten). IM ist dreifach karriererelevant: 1. Kompetenzzuschreibung qua Performance 2. Generierung sozialen Kapitals 3. Ausweisung sozialen Kapitals als Element des IM Alexander Stoll, Technische Universität Berlin, Institut für Soziologie, FG Kommunikations- und Mediensoziologie / Geschlechterforschung (Prof. Dr. Christiane Funken)
- 12. Begriffsklärung: Web 2.0 / Social Web / Social Software Web 2.0 = … "Chiffre" für mehrere Veränderungen, "die die Geschäftsmodelle, Prozesse der Softwareentwicklung und Nutzungspraktiken des Internets berühren." (Schmidt 2008:19) "The Web as platform": Zugang zu Diensten erfolgt im Web 2.0 vorrangig über das Web erfolgt und nicht über Desktop-Programme. (O'Reilly 2005) Leitbild des Web 2.0: "Nutzer als Sender" von Informationen (Produser) Dienste, die "Praktiken des Identitäts- und Beziehungsmanagements" erlauben (Schmidt 2008:21) Anwendungen des Web 2.0 = Social Software / Socialware = Wikis, Blogs, Social Networking Services Viele große Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern interne Web 2.0-Angebote an (Wikis, Blogs, Social Networking Sites). So auch das im Fokus dieser Untersuchung stehende Unternehmen. Alexander Stoll, Technische Universität Berlin, Institut für Soziologie, FG Kommunikations- und Mediensoziologie / Geschlechterforschung (Prof. Dr. Christiane Funken)
- 13. Begriffsklärung: Web 2.0 / Social Web / Social Software http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/ Alexander Stoll, Technische Universität Berlin, Institut für Soziologie, FG Kommunikations- und Mediensoziologie / Geschlechterforschung (Prof. Dr. Christiane Funken)
- 14. Begriffsklärung: Web 2.0 / Social Web / Social Software Social Networking Services (SNS) Blogs / Microblogs Wikis Alexander Stoll, Technische Universität Berlin, Institut für Soziologie, FG Kommunikations- und Mediensoziologie / Geschlechterforschung (Prof. Dr. Christiane Funken)
- 15. Theoretischer Zugriff – Handlung und Struktur Konzept der Nutzungspraxis (Jan Schmidt): Die situative Nutzung von Social Software wird durch drei strukturelle Dimensionen gerahmt: Regeln Adäquanzregeln (Medienwahl) prozedurale Regeln (Mediengebrauch, d.h. Kommunikation) Relationen Sind primär technischer Art, zeigen jedoch auch soziale Relationen an. Code Hard- und Software ermöglichen bestimmte Handlungen und schließen andere aus. Regeln, Relationen und Code spannen den Handlungsraum auf, in dem IM online möglich ist. Alexander Stoll, Technische Universität Berlin, Institut für Soziologie, FG Kommunikations- und Mediensoziologie / Geschlechterforschung (Prof. Dr. Christiane Funken)
- 16. Untersuchungsgegenstand: Web 2.0 bei der Deutschen Telekom Bei der DT existieren drei separate Social Software Plattformen: 1. People@Telekom = Social Network 2. Wikis 3. Blogs Diese bieten alle Möglichkeiten für Impression Management, sie sind jedoch … technisch unterschiedlich (Code), stehen im Kontext unternehmens- und ggf. bereichsspezifischer Adäquanzregeln, werden gemäß spezifischer prozeduraler Regeln genutzt und ermöglichen unterschiedliche Relationen. Sie bieten also differente Handlungsräume für IM. Alexander Stoll, Technische Universität Berlin, Institut für Soziologie, FG Kommunikations- und Mediensoziologie / Geschlechterforschung (Prof. Dr. Christiane Funken)
- 17. Fragestellung Welche Möglichkeiten zum Impression Management bieten die Web 2.0 Angebote des untersuchten Unternehmens? Werden die Web 2.0 Angebote für Impression Management genutzt – und erfolgt dies aus karrierestrategischem Kalkül? Lassen sich Unterschiede zwischen Frauen und Männern feststellen? Empirie: 5 Experteninterviews (durchgeführt, partiell ausgewertet) Online-Fragebogenerhebung (Fragebogen entworfen) Alexander Stoll, Technische Universität Berlin, Institut für Soziologie, FG Kommunikations- und Mediensoziologie / Geschlechterforschung (Prof. Dr. Christiane Funken)
- 18. Vorläufige Ergebnisse aus den Interviews Wikis, Blogs, SNS bieten alle das Potential zu Impression Management Adäquanzregeln Wikis z.B. werden oft rein projektbezogen genutzt unterschiedliche "Reichweite" für IM Teilweise Nutzen der Angebote für Mitarbeiter unklar Es existieren im Unternehmen verschiedene "Subkulturen" in unterschiedlichen Unternehmensbereichen, die zu differentem Nutzungsverhalten beitragen Social Networking Service wird teilweise von HR im Rahmen von Nachwuchsprogrammen genutzt, um auf Grundlage nutzergenerierter Informationen Projekte zu besetzen Prozedurale Regeln stark hierarchisch geprägte "Unternehmenskultur" wirkt auf Nutzung (insbes. Weitergabe von Wissen) Keine hierarchiefreie Kommunikation Ausgeprägtes IM via SNS nur innerhalb abgeschlossener Untergruppen Alexander Stoll, Technische Universität Berlin, Institut für Soziologie, FG Kommunikations- und Mediensoziologie / Geschlechterforschung (Prof. Dr. Christiane Funken)
- 19. Vorläufige Ergebnisse aus den Interviews Code: Unzureichende technische Integration der verschiedenen Plattformen mindert Nutzung Geschlechterdifferenz Frauen gegenüber Web 2.0 aufgeschlossener / affiner Alexander Stoll, Technische Universität Berlin, Institut für Soziologie, FG Kommunikations- und Mediensoziologie / Geschlechterforschung (Prof. Dr. Christiane Funken)
