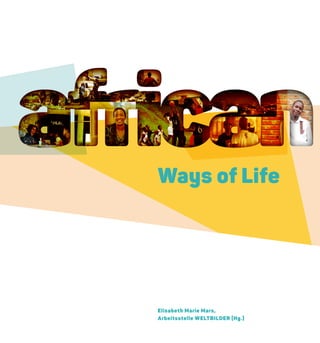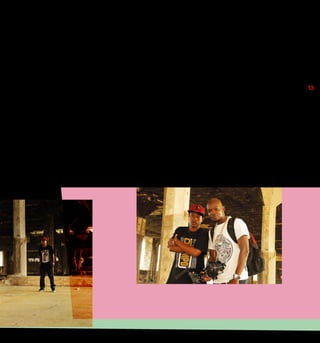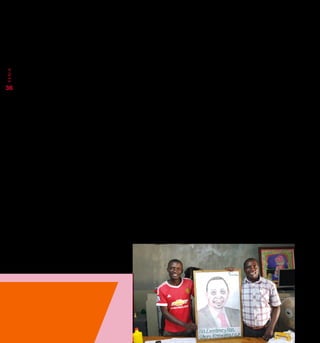Das Dokument behandelt das Buch "African Ways of Life", das verschiedenste Perspektiven und Geschichten afrikanischer Persönlichkeiten präsentiert, um das vorherrschende negative Afrika-Bild zu verändern. Es thematisiert die Dynamik und den Unternehmergeist junger Afrikaner*innen, insbesondere in Tansania, während es gleichzeitig auf die Herausforderungen hinweist, mit denen sie konfrontiert sind. Eine zentrale Botschaft ist die Aufforderung zur Anerkennung und Entwicklung der afrikanischen Identität und der Notwendigkeit, die Realität Afrikas zu transformieren.