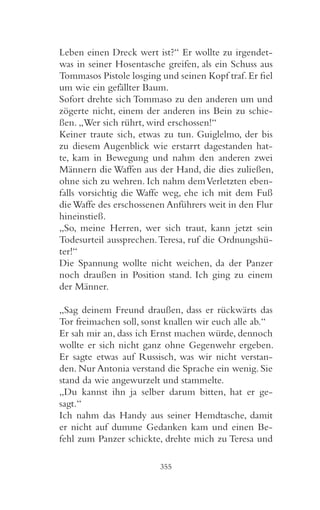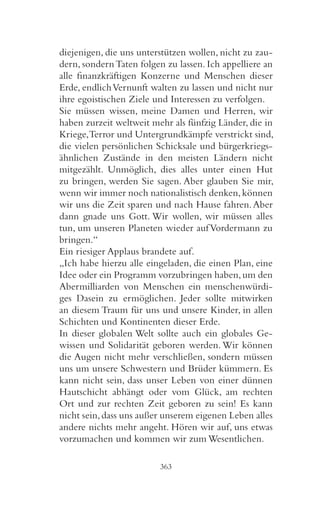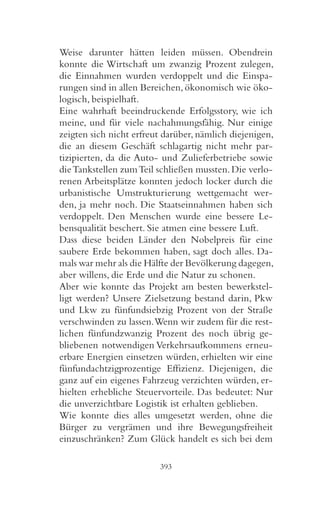In 'World Without Profit' beschreibt Angelo Nigro die Entstehung seines Buches, das aus einem traumhaften Verständnis der menschlichen Existenz und dessen Rolle im Universum entstand, wobei der Mensch als 'Salz der Erde' betrachtet wird. Das Werk kritisiert den materialistischen Ansatz der Gesellschaft und plädiert für ein Umdenken zu mehr Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Umwelt und den kommenden Generationen. Das Buch thematisiert auch die Herausforderungen, die der Klimawandel und die Profitgier großer Unternehmen für die Menschheit darstellen.